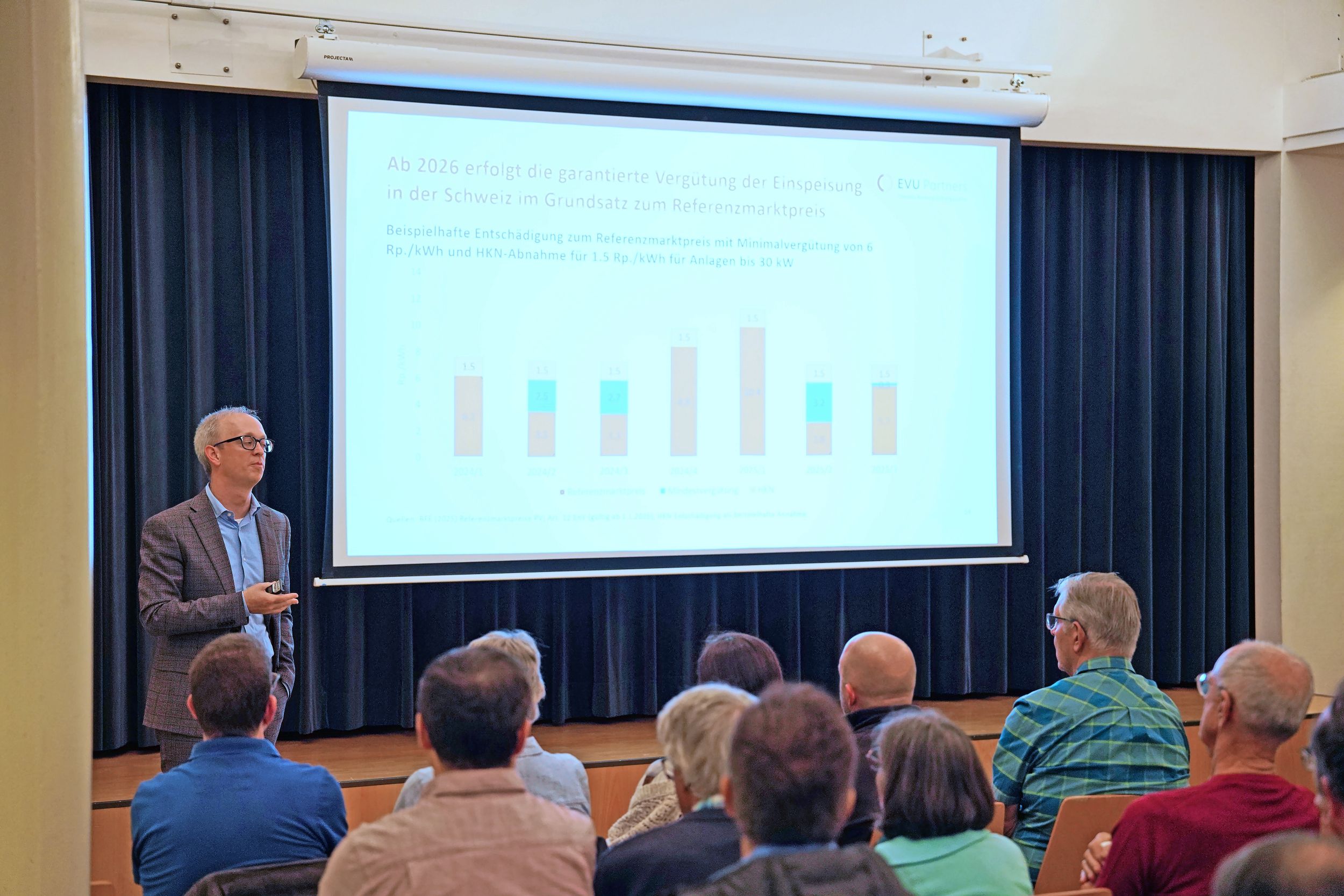Reider Stimmbevölkerung soll über Badi-Zukunft befinden
Reiden Medienmitteilung zur Badi Reiden AG
Am Muttertag, 11. Mai öffnet die Badi Reiden traditionsgemäss das Aussenbad. Wie es ab kommendem Jahr mit der Badi weitergehen wird, steht aber in den Sternen. Im Jahresbericht 2024 kommt der seit Juli 2023 amtierende Verwaltungsrat der Badi Reiden AG jedenfalls zu einem klaren Fazit: Unter den aktuellen Rahmenbedingungen lässt sich die Badi Reiden betriebswirtschaftlich nicht erfolgreich führen. Besonders stark drücken die für die Sanierung der Anlage aufgenommenen Fremdmittel auf die Ertragslage. Insgesamt muss Fremdkapital in der Höhe von 5.7 Mio. Franken verzinst und amortisiert werden. Weil der ordentliche Betrieb mit Hallenbad, Freibad, Restaurant und Aussenanlage die dafür nötigen Mittel nicht hergibt, fiel das Jahresergebnis 2024 mit – 335’692 Franken ähnlich negativ aus wie jenes von 2023 (-307’428 Franken).
Verbesserungen erreicht
Der Betrieb eines Aussenbades ist an sich bereits eine Herausforderung. Denn gegen die Launen des Wetters gibt es keinen Marketingplan. Ist es zu regnerisch, zu wechselhaft, zu heiss oder zu kalt, bleiben die Badegäste aus. Darunter litt 2024 auch die Badi Reiden insbesondere während des verregneten Sommerstarts. Der Rückgang der Schwimmbaderlöse hielt sich zwar über die ganze Saison mit 2.4 Prozent noch im Rahmen. Unerwartete Mehrkosten (Energie, IT, Reparaturen) beeinflussten aber das Gesamtergebnis trotzdem negativ. Dazu musste auch die aufgrund der angespannten Badifinanzen unterbrochene Erneuerung des Aussenbades soweit kompensiert werden, dass trotzdem ein gefahrloser Sommerbetrieb möglich war. Ein Teil der Mehrkosten konnte durch kreative Zusatzeinnahmen (Wohnwagenstellplätze, Catering) im Restaurantbetrieb kompensiert werden. Insbesondere die Aktivitäten rund um «Dinoworld» waren für die Badi erfolgreich, was sich in einem Plus von 15% bei den Restaurantumsätzen niederschlägt.
Schuldenlast drückt
Trotzdem blieb auch dem seit 1. Juli 2023 in neuer Besetzung aktiven Verwaltungsrat nichts weiter übrig, als erneut ein negatives Jahresergebnis zu präsentieren. Zwar konnte dieser die personelle Situation mit einem neuen Betriebsleiter und der Sicherstellung aller für den Betrieb nötigen Fachkompetenzen stabilisieren. Die Suche nach einem externen Betreiber des Restaurants aber musste erfolglos abgebrochen und die geplante Verpachtung vorerst sistiert werden.
Die finanzielle Situation der Badi bleibt damit angespannt. Zusätzlich verschärft hat sich die Situation nach der Erneuerung des Hallenbades. Die Kosten dafür fielen um fast 1 Mio. Franken höher als budgetiert aus. Der vom früheren Verwaltungsrat unternommene Versuch, diese Mehrkosten auf juristischem Weg einzutreiben, wurde im Sommer 2024 mangels Erfolgsaussichten abgebrochen. Damit haben sich auch die Hoffnungen auf Schadensmilderung zerschlagen, die zusätzlichen Kosten (Schulden, Verzinsung, Amortisation, Rechtsverfahren) müssen definitiv durch die Badi getragen werden.
Damit hat sich auch die Bilanz der Badi entsprechend verschlechtert. Inzwischen ist fast die Hälfte des Eigenkapitals aufgebraucht. Aufgrund dieser Entwicklung sieht sich der heutige Verwaltungsrat der Badi Reiden AG verpflichtet, seine Verantwortung wahrzunehmen. Nach dem ersten ganzen Geschäftsjahr und einer vertieften Analyse kommt er zu einem klaren Schluss: So wie heute kann die Badi Reiden nicht erfolgreich betrieben werden. Um die beliebte Freizeitanlage vor dem Konkurs zu bewahren, stellt er den Antrag, sie per 2026 in die Gemeindebetriebe zu integrieren.
Stimmbevölkerung wird entscheiden
Der Gemeinderat Reiden hat diese Zahlen und die Schlussfolgerung des Verwaltungsrates zur Kenntnis genommen. Er anerkennt die Bemühungen von Verwaltungsrat und Betriebsleitung der Badi, die wirtschaftliche Entwicklung in richtige Bahnen zu lenken. Ob und in welcher Form die Badi Reiden eine Zukunft hat, soll nun die Reider Stimmbevölkerung entscheiden. Der Gemeinderat will jetzt mögliche Zukunfts-Szenarien entwickeln und die Stimmbevölkerung Ende November 2025 entscheiden lassen.
Im Jahr 2019 stand die Reider Stimmbevölkerung schon einmal vor dieser Frage. Damals ging es um Sanierung oder Stilllegung der Badi. Eine Mehrheit sprach sich damals für die Sanierung der Badi und damit den Weiterbetrieb aus. Wie die Frage nun bei der geplanten Volksabstimmung am 30. November 2025 lauten wird, ist juristisch sehr komplex und wird noch mit den kantonalen Stellen geprüft. Denn sie muss auch dem Umstand Rechnung tragen, dass sich die Voraussetzungen zur Vorlage 2019 grundlegend verändert haben, weil Hallenbad und Restaurant inzwischen saniert sind.
Gemeinderat will Kostentransparenz schaffen
Mit einer Abstimmungsbotschaft und mehreren Informationsveranstaltungen will er eine breit abgestützte Meinungsbildung fördern. Er hat mit Blick auf diesen Volksentscheid folgende Schritte eingeleitet: Zur Betriebssicherung für den Sommer 2025 und zur Sicherung der bisher geleisteten Investitionen bzw. der Arbeitsplätze hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, einen Konkurs der Badi zu verhindern. Er hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die aktuell anstehenden Amortisationszahlungen für einen Zusatzkredit der Badi zeitlich zur Finanzierung der Kostenüberschreitungen bei der Badi befristet ausgesetzt werden. Der Betrieb von Hallen- und Freibad sind so zumindest für 2025 gesichert. Dazu hat der Gemeinderat in der Jahresrechnung 2024 in Kenntnis der Entwicklung bereits Wertberichtigungen an den Aktien im Umfang von 400’000 Franken vorgenommen. Der Gemeinderat will für den politischen Meinungsbildungsprozess im Hinblick auf den Urnengang Ende November die nötigen Fakten transparent und ausgewogen zusammenstellen. Er hat den aktuellen Verwaltungsrat der Badi Reiden AG deshalb beauftragt, die Kosten für verschiedene Szenarien zu berechnen. Deren Stossrichtungen decken das gesamte mögliche Spektrum ab: Vom Weiterbetrieb (unter neuen Organisationsstrukturen) über einen reduzierten Betrieb von Teilen oder eine Totalschliessung und Verkauf der Anlage bis zu einem Teilabbruch der Badi.
Der Gemeinderat will die Bevölkerung aktiv über die Entwicklung informieren. Nach der Information vom 29. April sieht er eine weitere Information im 2./3. Quartal 2025 vor. Bis dahin will er die nötigen Fakten zusammengetragen und die Eckdaten der Abstimmungsbotschaft ausgearbeitet haben. Dies betrifft die Kosten der verschiedenen Szenarien genauso wie auch die am Urnengang im November zu beantwortenden Fragen. Im Herbst schliesslich wird er an einer Orientierungsversammlung die Abstimmungsbotschaft vorstellen und sich erneut den Fragen der Bevölkerung stellen.
Mit dem Urnengang von Ende November soll in Reiden die Badi-Frage abschliessend geklärt werden. Immer wieder hat die ursprünglich genossenschaftlich organisierte Freizeitanlage in der Vergangenheit für politischen Zündstoff gesorgt. Nun will der Gemeinderat die volle Kostentransparenz herstellen. Wenn sich die Bevölkerung also für einen Weiterbetrieb der Badi aussprechen sollte, dann muss das Preisschild dafür bekannt und mit einem realistischen Businessplan belegt sein.

Vom Gurgelischmeichler über den Adebar bis hin zum Hellraiser
Brittnau Am 25. April ist Tag des Schweizer Biers
Treffpunkt Vorstadtweg in Brittnau. Beat Ruf steht vor seinem Eigenheim schon bereit. «Von hier aus ist es nicht weit zur Brauerei», sagt er, «wir können den Weg gut unter die Füsse nehmen». Und schon beginnt Ruf zu erzählen, wie er aufs Bierbrauen gekommen ist. Er sei schon immer Bierliebhaber gewesen, führt der 59-Jährige aus, der ursprünglich den Beruf eines Forstwarts erlernt und während zwölf Jahren auch praktiziert hat, heute aber im Einkauf und in der Produktionsplanung bei einem Hersteller von Schachtabdeckungen und Entwässerungsrinnen in Härkingen tätig ist. Aber in der Zeit um 2015 herum, als er sich in Büchern einiges an Wissen über Biere und das Brauen angelesen habe, sei es nicht so einfach gewesen, handwerklich hergestellte Biere zu kaufen. «In den Regalen der Grossverteiler gab es damals praktisch keine Craft-Biere». Er habe sich vertieft informiert und dann 2016, nach einem Braukurs beim Brau- und Rauchshop, dem bekannten Anbieter von Brauartikeln, sein erstes eigenes Bier hergestellt. «Ich weiss nicht, ob ein Bierkenner das Bier auch gut gefunden hätte, aber mich hat es damals unheimlich begeistert», sagt er.
Beat Ruf hat es, wie er selber sagt, «so richtig den Ärmel reingenommen». Hat mit dem Brauen begonnen – in den ersten Jahren jede Woche. Und damals noch in Kunststoffbecken. Schon 2017 hat er sich als steuerpflichtige Brauerei registrieren lassen, weil er die zugelassene Freimenge von 400 Litern überschritt. «So, hier sind wir», sagt Beat Ruf, in einem altgedienten Schlachthaus in unmittelbarer Nachbarschaft hat er seine Brauerei eingerichtet. Ruf schliesst die Türe auf, von Kunststoffbecken keine Spur mehr. Statt Kunststoffbecken stehen Gärtanks in Edelstahl im Raum. «Ich konnte meine Biere schon früh in die Gastronomie liefern», führt er erklärend aus, das habe Investitionen und eine gewisse Professionalisierung bedingt. Gleich beim Eingang hat Ruf auf einer Pinwand eine beeindruckend grosse Anzahl Etiketten seiner bisher gebrauten Biersorten aufgeklebt. «Die Vielfalt der Bierstile in der Szene der Kleinst- und Kleinbrauereien ist in der Schweiz enorm», betont Ruf. Es sei eine Szene, die lebe und sehr innovativ sei.
Grosse Vielfalt an Craft-Bieren
Das war nicht immer so, wie ein kleiner Exkurs zum Schweizer Biermarkt aufzeigt. 1935 hatten sich die schweizerischen Brauereien darauf geeinigt, den Konkurrenzkampf auszusetzen. Das Bierkartell kam ab den 1970-er-Jahren ins Wanken, die Auflösung des Kartells erfolgte aber erst 1991. Parallel dazu gab es in dieser Zeitspanne immer weniger Brauereien. 1935 waren es noch 60, bei der Auflösung des Kartells noch ganze 31.
Die Grossbrauereien wurden allesamt ins Ausland verkauft. Calanda-Haldengut ging 1994 an den holländischen Heineken-Konzern, der mittlerweile fusionierte Riese Feldschlösschen-Hürlimann 2000 an die dänische Carlsberg-Gruppe. Als Heineken 2008 die Getränkesparte von Eichhof kaufte, ging auch noch der letzte Schweizer Biertitel von der Börse. Eine Gruppe von Regionalbrauereien – die bedeutendste ist die Appenzeller Brauerei Locher – blieb im Grosshandel vertreten und konnte sich konsequent gegen Übernahmeangebote wehren.
Im Schatten der grossen und mittleren Brauereien formte sich eine dritte Sparte von Produzierenden: die Mikrobrauereien. Seit dem Ende des Kartells ist ihre Anzahl regelrecht explodiert – der Schweizer Biermarkt begann von unten richtiggehend zu gären. 2010 gab es bereits 322 steuerpflichtige Brauereien, 2015 waren es schon 623. Mit 1278 registrierten Brauereien erreichte diese Entwicklung 2021 ihren Höchststand. Seither reduzierte sich die Zahl der Mikrobrauereien in der Schweiz wieder leicht, 2024 waren noch 1149 Brauereien registriert. «Ganz klar, der Zenith bei Kleinstbrauereien ist erreicht oder eher schon überschritten», findet auch Beat Ruf.
In der Schweiz fehlt eine Bierkultur
Dafür gebe es verschiedene Gründe, meint der Brittnauer «Storchenbrauer». Der Bierkonsum sinkt in der Schweiz stetig. Rannen 1991 noch 71 Liter Bier durch jede Schweizer Kehle, so sank der Pro-Kopf-Konsum im vergangenen Jahr erstmals unter die 50-Liter-Marke. Zudem gehe der Alkoholkonsum generell zurück, hält Ruf fest. Das zeigt sich auch darin, dass mehr alkoholfreie Biere produziert und abgesetzt werden.
Dann öffnet Ruf die Türe zum Lagerkeller. «Ich habe momentan rund dreissig verschiedene Biere an Lager», sagt Ruf nicht ohne Stolz. Ein Imperial Stout, das ist der grosse Bruder vom Guiness – sehr geschmacksintensiv. Adebar ist ein belgisches Tripel-Bier, hell, spritzig, geschmacksintensiv. Pale Ale, da gibt es verschiedene Arten. «Dann mache ich jedes Jahr ein Weihnachtsbier mit den typischen Zutaten wie Sternanis, Koriander, Zimt, Ingwer oder Orangenschale», führt Ruf weiter aus und kommt dann zu einem seiner Lieblingsbiere – ein Nelson Saison, ein trockenes Bier mit wenig Restzucker, spritzig, schmeckt nach Stachelbeeren, leicht pfeffrig. Ein 4805, ein helles Lagerbier, gebraut mit Hopfen aus dem eigenen Garten. Ein Oktobier, ein leicht rauchiges Amberbier. Ein Drunken Stork mit sehr viel Alkohol, dunkel, vollmundig mit Restsüsse. «Das Gurgelischmeichler ist mein Paradebier», sagt der Brittnauer Brauer, ein Pale Ale, das er seit Beginn an mache, fruchtig, hopfig. Ein Braveheart mit Whiskygeschmack und Erikablüten als Zutat. Ein Rauchbier, ein Maisbier, und, und, und …
Die Bierwelt des Beat Ruf ist riesig. «Mich fasziniert das Experimentieren – und es gibt wohl fast keine Bierarten, die ich nicht schon gebraut habe», betont Beat Ruf, davon leben müssen, das möchte er aber nicht. «Das wäre auch schwierig», sagt Ruf, denn die Schweiz kenne keine Bierkultur, wie sie etwa Deutschland, Frankreich oder Belgien haben. So gebe es in der Region oder überhaupt in der Schweiz nur vereinzelte Restaurants, die eine separate Bierkarte hätten. Und tatsächlich ist es ja auch so: Rund 70 Prozent allen Biers, das in der Schweiz getrunken wird, ist Lager-Bier. Die rund 1000 Craft-Bier-Produzenten ringen nach wie vor um einen verschwindenden Marktanteil von wenigen Prozenten. Das zu ändern sei schwierig, sagt Ruf. Eine Idee hätte er aber schon: «Am liebsten würde ich einmal sämtliche Wirte der Region in meinem Braukeller durch die grosse Welt der Biere führen».

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Schmackhafte und gesunde Wildpflanzen für den Frühling
Region Einheimische Pflanzen besitzen nicht nur Heilkräfte
Wildkräuter sind ein wahrer Quell an Vitaminen und Mineralien. Sie können superlecker schmecken und sind an vielen Orten zu finden. An Waldrändern, Hecken und nährstoffreichen Wiesen lassen sich viele der Pflanzen ernten. Gerade weil Wildkräuter oft üppig und in grosser Auswahl in der Natur frei verfügbar sind, wird vergessen, dass auch diese kostbare Produkte sind. Deshalb soll das Ernten mit viel Rücksicht und Respekt erfolgen, um die Natur zu schonen.
Spitzwegerich
Der Spitzwegerich gilt als kleine Wunderpflanze. Bereits in der Antike wurde die Heilwirkung der Pflanze genutzt. Doch auch als Speisepflanze eignet sich der Spitzwegerich hervorragend. Die feinen Blätter der Rosettenmitte werden geerntet und sollten am besten quer zur Faser in Streifen geschnitten werden. Die geschnittenen Blätter eignen sich als Zugabe von Salaten und gekochtem Gemüse, oder können auch im Omelette oder Rührei verarbeitet werden.
Wiesen-Labkraut
Mit seinen schmalen Teilblättchen, die zu mehreren rund um den Stängel angeordnet sind, ist das Labkraut unverkennbar. Fast das ganze Jahr kann man die Stängel zu Blattgemüsegerichten verarbeiten. Sie sind eine ausgezeichnete Salatgrundlage und man kriegt fast nicht genug von dem milden, saftigen Kraut.
Knoblauchsrauke
Wie der Name schon andeutet, ist der Knoblauchgeschmack bei dieser Pflanze unverwechselbar. Die Blätter und Triebe können als Grundlage verschiedener Salate dienen oder schmecken auch hervorragend als Zutat eines Kräuterquarks. Die Blüten eignen sich als würzige, helle Speisedekoration.
Gewöhnlicher Gundermann
Die Pflanze, die auch als wilde Petersilie bekannt ist, hat einen herben, würzigen Geschmack. Im April sind die Blätter noch zart und frisch, im Verlauf des Sommers lagern sich jedoch immer mehr Bitterstoffe ein. Sie eignen sich besonders zum Würzen von Suppen, Reisspeisen, Quiche, Eintöpfen und können zu Kräuterbutter verarbeitet werden.
Löwenzahn
Die Verwendung von Löwenzahn in der Küche vielseitig, und seine Heilwirkung als verdauungsfördernd und harntreibend hilfreich. Die jungen, frischen Blätter eignen sich besonders als Salatzugabe. Wenn man die Blätter, fein geschnitten, für eine Stunde in Salzwasser ziehen lässt, werden sie etwas milder. Verglichen mit einem Kopfsalat, ist der Löwenzahn um ein Vielfaches reicher an Vitaminen, Calcium, Magnesium, Eisen und Proteinen.
Die noch ungeöffneten Blüten sind wahre Delikatessen. Angebraten mit etwas Olivenöl, oder eingelegt als Kapern in Essig können sie als Beilage für alle möglichen Gerichte dienen. Doch auch die geöffneten Blüten lassen sich verwenden. Die feinen Blütenspitzen können als Speisedekoration dienen, oder auf ein Brot gegeben werden. Eingelegt in Zuckerwasser kann ein wunderbar reichhaltiger Honig hergestellt werden.
Wiesen-Schaumkraut
Die Pflanze ist in der Familie der Kreuzblütler und somit verwandt mit dem kultivierten Kohlgemüse wie beispielsweise Broccoli, Rosenkohl, Weisskohl, Senf oder Raps. Daher schmecken auch die Blätter des Wiesen-Schaumkrauts kresseartig und eignen sich zum Schärfen von Salaten, Kräuterbutter oder Suppen.

Bild: Regina Lüthi

Blätter der Knoblauchsrauke schmecken hervorragend im Kräuterquark.
Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Viktor – stock.adobe.com

Vogelküken in Not – oder doch nicht?
Oftringen Die Vogelpflegestation will sensibilisieren
Doch wann braucht ein Vogel tatsächlich Hilfe? Scheinbar hilflos sitzen im Frühling die kleinen Küken am Boden und mancher Tierfreund von Mitleid übermannt nimmt den Piepmatz kurzerhand mit und bringt ihn in eine Vogelpflegestation. Ein Grossteil der eingelieferten Patienten hätte aber gar keine Hilfe benötigt. Manchmal lässt gerade diese menschliche Hilfe ein Vogelkind zum Pflegefall werden. Sind die kleinen flügge, müssen sie nicht nur das Fliegen und die Suche nach Nahrung erlernen, sondern auch die Gefahren des Vogellebens ausserhalb des Nestes kennenlernen. Unter den Augen der Eltern hüpfen und flattern sie einige Tage am Boden und auf Ästen herum und durchlaufen so die Schule des Lebens. Verhalten sich die Jungen ruhig, sind die Eltern wohl auf Futtersuche, weit weg sind sie nicht. Diese Vögel brauchen keine menschliche Fürsorge.
Verletzte Tiere brauchen immer Hilfe
Küken, die noch nicht vollständig befiedert sind, setzt man am besten wieder ins Nest zurück. Ist das nicht möglich, brauchen auch die Hilfe. Bei Unsicherheit kann ein Anruf bei einer Fachstelle Abhilfe schaffen.
Erst beobachten, dann handeln
Gesund wirkende Jungvögel mit vollständigem Gefieder sind am Fundort zu belassen. Sind keine Eltern in der Nähe mindestens ein bis zwei Stunden aus sicherer Entfernung beobachten. Ist das Vogelkind durch Verkehr oder Katzen gefährdet, sollte es in ein Gebüsch, auf einen Ast oder in eine Hecke versetzt werden. Jedoch maximal 20 Meter vom Fundort entfernt. Die Eltern werden es finden und sich weiter um ihren Nachwuchs kümmern. Rufen Sie zuerst an, bevor sie den Vogel einfach mitnehmen. Am Telefon unter 079 568 95 03 oder 079 289 27 76 erhalten Sie Beratung.
Sind im Garten junge Piepmätze flügge, sollte man den Katzen ein Glöckchen umbinden oder ein paar Tage Hausarrest verpassen. Die Vögel werden es danken, die Katzen werden es verzeihen.
Von April bis August sollten keine Sträucher geschnitten werden, denn das sind die Brutorte der gefiederten Freunde.
Wer Lust und Zeit hat, in der Vogelpflegestation mitzuhelfen, oder wer mit der Familie ein Nistkastenrevier betreuen möchte, kann sich über www.nvo-oftringen.ch informieren und melden.

Bild: zvg

Die Borna mit ihrer Offenheit und Herzlichkeit geprägt
Rothrist Letzter Arbeitstag von Christine Lerch in der Borna
Ein ganz stiller Abschied hätte es werden sollen, wenn es nach dem Willen von Christine Lerch gegangen wäre. «Doch eine Leiterin, die sich während 15 ½ Jahren stets mit vollem Engagement für ‹ihre› Borna eingesetzt hat, einfach so ziehen zu lassen, das geht gar nicht», betonte Fabrice Bernegger, der seit dem 1. Januar diesen Jahres die Gesamtleitung der Rothrister Arbeits- und Wohngemeinschaft von Christine Lerch übernommen hat. Und mit ihm waren auch Bewohnende, Mitarbeitende, Geschäftsleitung und Verwaltungsrat der gleichen Ansicht.
So versammelte sich denn gefühlt die gesamte Borna-Familie am letzten Freitag im Speisesaal, um dort eine doch etwas überraschte Christine Lerch zu den jazzigen Klängen der «Loamvalley Stompers» zu empfangen. «Ihr seid also auch da», meinte die scheidende Gesamtleiterin zu den fünf Musikern aus dem Leimental, die in den letzten 15 Jahren bei so manchem Event in der Borna aufgespielt hatten.
Eine faszinierende und herausfordernde Arbeit
Fabrice Bernegger hiess dann die Borna-Familie und insbesondere Christine Lerch herzlich willkommen. Mit einem Blick in die Vergangenheit. Am 1. Dezember 2009 habe Christine Lerch ihren ersten Arbeitstag in der Borna gehabt. «Das war ein Sonntag. So wie wir Christine kennen, hat sie an diesem Sonntag wahrscheinlich bereits gearbeitet», meinte Bernegger. Und dann weitere 5641 Arbeitstage, an denen sie nicht selten noch die eine oder andere Stunde angehängt habe oder sogar ganze Nächte. Christine Lerch sei eine «Chrampferin» gewesen, die von Beginn an immer das Wohl der ihr anvertrauten Menschen in den Vordergrund gestellt habe. Sie habe sich immer Zeit genommen, ihre Türe sei jederzeit offen gestanden. «Meine Arbeit zum Wohle der behinderten Menschen macht mir grosse Freude, sie ist faszinierend und konfrontiert mich immer wieder mit neuen Herausforderungen. Ich erachte sie als grosse Chance.» So hat sich Christine Lerch denn auch in ihrem ersten Interview als Gesamtleiterin der Borna in einem Zeitungsartikel geäussert. Die Freude an der Arbeit – das hat Christine Lerch bis zum letzten Tag vorgelebt. «Ich habe meinen Teams immer gesagt: Verhalten macht Verhalten». Deshalb sei es ihr immer wichtig gewesen, nicht mit einem «suure Stei» zum Arbeiten zu kommen.
Mit viel Lebenserfahrung und breiter Ausbildung
Im gleichen Zeitungsartikel gab Christine Lerch damals einen Einblick in ihr Leben und in ihre Ausbildungen. Christine Lerch ist in Brittnau aufgewachsen, hat nach der obligatorischen Schulzeit ein Haushaltlehrjahr auf einem Bauernhof im Welschland und anschliessend die Bäuerinnenschule absolviert. Daran schloss sich ein zweijähriger Au-pair-Einsatz in Rotterdam an, anschliessend ein Sprachaufenthalt im italienischen Perugia. Nach einer weiteren Ausbildung zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin in Zürich, arbeitete Christine Lerch in dieser Funktion während zwei Jahren in Afrika. Zurück in der Schweiz konnte sie ihre Fähigkeiten übergangsweise als Heimleiterin in einem Sonderschulheim unter Beweis stellen. Und damit es ihr damals auch nicht langweilig werden konnte, hat sie an der Fachhochschule in Olten berufsbegleitend den Master of Human Ressources (Personalmanagement) abgeschlossen.
Weit gereist, mit grosser Lebenserfahrung und einem breiten Rucksack an Ausbildungen – 2009 hat sich Christine Lerch auf die ausgeschriebene Stelle als Gesamtleiterin in der Borna bewerben. Aus über hundert Bewerbungen – von Fachkräftemangel sprach damals kein Mensch – wurde Christine Lerch als Nachfolgerin von Fritz Bär gewählt. «Heute, über 15 Jahre später ist die Borna mit Christine, oder Christine mit der Borna gewachsen», hielt Fabrice Bernegger fest. Viele Herausforderungen seien gemeistert und grosse Projekte realisiert worden.
Grösstes Projekt auf der Zielgerade
Dass es gerade bei Projekten einen langen Atem brauche, das habe Christine Lerch insbesondere beim Neubauprojekt erfahren müssen, meinte Verwaltungsratspräsident Felix Schönle. Vor elf Jahren wurde beim Kanton ein erstes Bauprojekt angemeldet. Dann verhängte der Kanton ein zweijähriges Moratorium, weil kein Geld vorhanden war. 2016 wurde die Baueingabe abgelehnt und von der Borna eine Überarbeitung der Strategie verlangt. 2017 wurde die Strategie überarbeitet und ein neues Bauprojekt eingereicht, welches kurz vor Weihnachten 2017 genehmigt wurde. Damit war der Weg frei für die ersten beiden Projektphasen, das Präqualifikationsverfahren und die Ausschreibung des Wettbewerbs. 2019 wurden sechs Generalplanerteams ausgewählt und zur Teilnahme am Studienauftrag eingeladen, welcher dann mit der Wahl des Projekts «Bornapark» als Siegerprojekt endete. 2021 wurden die Baupläne beim Kanton eingereicht und sage und schreibe acht Jahre nach der ersten Eingabe erfolgte Ende 2022 die Baubewilligung. Seit 2023 ist die Borna in der Bauphase, die neuen Räumlichkeiten können in diesem Sommer bezogen werden. «Ich erwähne das, weil uns das Bauprojekt extrem forderte», betonte Felix Schönle. Denn neben der alltäglichen Arbeit hätten viele zusätzliche Sitzungen stattfinden, viele Entscheide gefällt und auch manches Problem beseitigt werden müssen. «Christine Lerch war immer mit dabei und hat überall dort tatkräftig unterstützt, wo Not an der Frau war», betonte der Verwaltungsratspräsident. «Liebe Christine, ich dank Dir im Namen des gesamten Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung, aller Mitarbeitenden und Klienten für alles, was Du für die Borna geleistet hast. Du kannst stolz darauf sein, deinem Nachfolger eine gute Geschäftsleitung und eine tolle Institution zu übergeben», meinte Schönle weiter.
Borna entdecken
Und dann durften sich Bewohnende und Mitarbeitende nochmals persönlich von ihrer langjährigen Gesamtleiterin verabschieden. Sie taten das mit vielen herzlichen Worten, Umarmungen Geschenken und Blumen, sodass ein Blumenstrauss entstand, der wohl einen Eintrag ins Guiness Buch der Rekorde verdient hätte. Und ja, dank einem ganz besonderen Geschenk darf Christine Lerch Borna entdecken. Findige Köpfe in der Borna fanden nämlich heraus, dass es in der Nähe von Leipzig ein Städtchen namens Borna gibt. Dorthin darf Christine Lerch reisen und Borna entdecken.
Doch zurück nach Rothrist: Auch dort wird man die Borna bald neu entdecken können. Denn der Neubau ist in letzter Zeit rasant fortgeschritten. So weit fortgeschritten, dass die neuen Gebäude an einem Tag der offenen Baustelle nochmals besichtigt werden können, bevor sie dann bezogen werden. Und zwar am Samstag, 31. Mai.

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Schlendern, degustieren und die Sonne geniessen – so schön kanns sein
Zofingen Das herrliche Wetter lockte viele Interessierte an den Monatsmarkt
Der Monatsmarkt in der Zofinger Altstadt bot am vergangenen Donnerstag ein herrliches Bild. Zahlreiche Menschen schlenderten durch die Gassen, liessen sich von den Angeboten inspirieren und tauschten sich mit den Händlern aus. Glace und Zuckerwatte waren beliebt an diesem Nachmittag.
Vom grossen Plüschtier bis zu dekorativen Arbeiten und Schmuck leuchtete und glänzte alles in der Sonne um die Wette. Ob Süsses, Saures oder Herzhaftes – der Monatsmarkt bietet sehr viel mehr als «einfach nur» Obst und Gemüse. Neben der Stadtkirche drehte ein Karussell seine Runden zu fröhlicher Musik, es duftete nach frischen Mandeln und anderen Leckereien.
Das wunderbare Frühlingswetter, das Ambiente des Marktes und die vielen gut gelaunten Besucherinnen und Besucher taten richtig gut. Wer eine Pause brauchte vom Stöbern, oder das bunte Treiben beobachten wollte, nahm sich die Zeit und verbrachte sie in einem der Cafés, um die Sonne zu geniessen.

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Mit neuem Präsidenten und neuem Bulletin-Chef in die Zukunft
Oftringen 54. DV der Vereinigung der Ortsvereine
Eingeladen hatte der abtretende Vereins-Präsident und Bulletin-Redaktor René Wullschleger. Mit ihm hatte auch Vorstandskollege Bruno Berger als Zuständiger für das Oftringer Bulletin, seinen Rücktritt auf die diesjährige Delegiertenversammlung eingereicht. Neben den ordentlichen Geschäften standen somit die Erneuerungswahlen des Präsidenten und der Gesamtleitung/Koordination Oftringer Bulletin auf der Traktandenliste.
René Wullschleger konnte den Anwesenden, darunter mit Ammann Hanspeter Schläfli und Vizeammann Markus Steiner die beiden höchsten Vertreter der Gemeinde, zwei aus ihrer Sicht «würdige Nachfolger» präsentieren. Der langjährige Bulletin-Redaktor Adrian Gaberthüel stellte sich als Gesamtleiter/Koordinator Bulletin zur Verfügung. Als erfahrener Medienspezialist wird er mit einem neuen Team ab sofort die Produktion des beliebten Oftringer Bulletins verantworten.
Als Nachfolge im Präsidium konnte René Wullschleger der Versammlung den Unternehmer Roger Willimann empfehlen. Als Gastronom im Bad Lauterbach ist auch er in Oftringen kein Unbekannter. Entsprechend bestätigte die Versammlung die beiden neuen Vorstandsmitglieder einstimmig.
Die ersten Ehrenmitglieder in der Geschichte
Über 30 (!) Jahre waren sowohl Bruno Berger als auch René Wullschleger für das Bulletin zuständig. 1991 als Delegierter des Gewerbevereins Oftringen in den Vorstand des VOOK gewählt, übernahm Bruno Berger zwei Jahre später vom ehemaligen Gründer Hans Streit die Leitung des Oftringer Bulletins. Auf der Suche nach einem Redaktionsteam stiess er sodann auf René Wullschleger, der in der Folge dessen Leitung übernahm. Berger kümmerte sich fortan um die Inserate und behielt die Gesamtkoordination.
Gemeindeammann Hanspeter Schläfli ehrte die zwei langjährigen Bulletin-Mitarbeitenden in einer Laudatio: «Die beiden haben wesentlich dazu beigetragen, dass sich das Bulletin, wie wir es heute jeden zweiten Monat in den Briefkästen vorfinden, zu einer beliebten Lektüre entwickelt hat und in sehr vielen Haushaltungen als wichtiges Nachschlagewerk dient».
Dass die Vereinskassen (Verein und Bulletin) das vergangene Jahr mit einem Plus abschlossen, nahmen die Delegierten zur Kenntnis. Dies war an diesem Abend aber eher Nebensache.

Tiefer Wasserstand macht Fischen aktuell nicht zu schaffen
Aarburg Die Artenzusammensetzung in der Aare hat sich verändert
Wer jetzt einen Spaziergang der Aare entlang macht, dem fällt auf: Der Wasserstand ist tief. Ein Blick auf die bei Murgenthal gemessenen Abflussmengen bestätigt das: Flossen im Januar durchschnittlich 389 Kubikmeter Wasser die Aare runter, so sank der Mittelwert im Februar auf 241 Kubikmeter, im März waren es gar nur noch 134 Kubikmeter. Damit lag der Wert im März ganz nahe bei den Abflusswerten aus dem heissen Jahr 2022, als es gar nur 128 Kubikmeter waren. In eben diesem 2022, als der Schweizerische Fischerei-Verband in einer Pressemitteilung verlauten liess: «Für die Fische stehen die Zeichen auf Tragödie». Wie also sieht es momentan unter Wasser aus, zumal Regenfälle in den nächsten Tagen nicht zu erwarten sind? Die Frage richtet sich an drei Experten, den kantonalen Fischereiaufseher Samuel Gerhard (Oftringen) sowie zwei ehrenamtliche Fischereiaufseher des Fischervereins Aarburg, Hansruedi Joss (Aarburg) und Roland Sommer (Strengelbach).
Von Alarmstimmung ist bei den drei Fischereiaufsehern nichts zu spüren. Für die Fische ist die Lage momentan nicht bedenklich – wir haben einen Wasserstand, wie er für diese Jahreszeit nicht unüblich ist», hält Hansruedi Joss fest. Zudem sind die Temperaturen momentan auch noch tief. Die Laichzeit von Frühjahrslaichern wie Äsche oder Hecht habe eingesetzt, jene von Alet, Barbe und anderen Fischarten werde folgen, sobald das Wasser wärmer sei, führt Joss weiter aus. Jetzt sei es wichtig, dass nicht plötzlich ein Zuviel an Wasser komme. «Denn ein plötzliches Hochwasser würde den Laich möglicherweise negativ beeinträchtigen oder gar wegschwemmen», betont der 66-jährige Aarburger Spenglermeister, der wie seine beiden Kollegen seit Jugendtagen ein begeisterter Fischer ist. Auf der anderen Seite brauche es in den kommenden Wochen und Monaten wieder mehr Wasser, meint Samuel Gerhard. «Ein tiefer Wasserstand wird dann zum Problem, wenn die Temperaturen steigen und sich das Wasser (zu) stark erwärmt», betont der 62-jährige Fischereiaufseher. Denn Fische reagieren sensibler als andere Lebewesen auf noch so kleine langfristige Temperaturschwankungen.

Bild: Thomas Fürst
Viele Fischarten sind in Gefahr
Gerhard schätzt, dass die durchschnittlichen Wassertemperaturen in der Aare in den letzten fünfzig Jahren um etwa 1,5 Grad angestiegen sind. Tönt nach wenig, ist aber für Fische viel. «Für die Fische stehen die Zeichen auf Tragödie», diese Aussage von 2022 gelte heute noch – zumindest für Kaltwasser liebende Arten, hält Samuel Gerhard fest. In der Aare seien insbesondere Äschen, Forellen und Barben davon betroffen. «Gerade bei den Äschen haben wir beim Laichmonitoring in den letzten beiden Jahren ganz schlechte Ergebnisse erhalten», sagt Roland Sommer. Dies deute darauf hin, dass es in der Aare möglicherweise weniger grosse Muttertiere gebe. Bei Äschen und Forellen wird auch kein Besatz – darunter versteht man das Aussetzen einer grösseren Anzahl von Fischen in ein Gewässer – mehr vorgenommen. Aus gutem Grund, wie der 56-jährige Sommer betont: «Erfolge blieben aus – die Fischbestände konnten auf diesem Weg nicht erhöht werden.»
Auch das Schweizerische Bundesamt für Umwelt (BAFU) stuft die Lage für Fische in den Schweizer Seen und Flüssen immer schlechter ein. Laut der 2022 veröffentlichten «Roten Liste der Fische und Rundmäuler» werden die Schweizer Gewässer aktuell von 90 Arten besiedelt, wovon 19 nicht zur einheimischen Fischfauna zählen. Das BAFU hat den Gefährdungsgrad der 71 einheimischen Arten analysiert. 9 Arten sind in den letzten 100 Jahren in der Schweiz ausgestorben, 15 sind vom Aussterben bedroht, 8 sind stark gefährdet, 11 verletzlich und 9 Arten sind potenziell gefährdet. Von den verbleibenden 19 einheimischen Arten gelten nur gerade 14 als nicht gefährdet, bei 5 Arten reichen die vorhandenen Daten und Kenntnisse nicht aus, um ihnen einen Gefährdungsstatus zuzuordnen. Fazit: Die Fische gehören in der Schweiz zu den am stärksten gefährdeten Tierarten überhaupt.
Fangzahlen sind relativ stabil geblieben
Logischerweise müsste also auch der Fischbestand in der Aare abgenommen haben? Samuel Gerhard lacht und sagt: «Die Aare ist unergründlich». Aussagen über den Fischbestand in der Aare zu machen, sei schier unmöglich. Es gelte zu bedenken, dass rund 90 Prozent der Aare nicht befischt würden. Zudem wandern Fische auch. Im Winter werden von verschiedenen Fischarten Winterhabitate bezogen. Je nach Fischart gibt es auch Laichwanderungen über viele Kilometer. Durch dieses Wanderverhalten der Fische gibt es riesige Unterschiede der lokalen Fischdichte. So gebe es zum Beispiel Tage, ja sogar Wochen, da fange man kein Egli – und plötzlich seien sie wieder da. «Was man aber mit Bestimmheit sagen kann: Es hat in der Aare heutzutage deutlich mehr Welse als früher und der Alet zählt auch zu den Gewinnern», betont er. Anders ausgedrückt: Die Artenzusammensetzung hat sich verändert. Es sind vor allem die wärmeliebenden Arten wie Alet, Egli, Karpfen, Wels, Zander oder Hecht, welche auf dem Vormarsch sind. Das zwinge auch die Petrijünger zum Umdenken. «Wir können nicht mehr auf Forelle jagen, sondern müssen Wels jagen», betont Hansruedi Joss.
Veränderungen, die in diese Richtung zielen, zeigen sich auch in der kantonalen Fischfangstatistik. Die Zahl der in der Aare gefangenen Fische ist seit 2013 mehr oder weniger stabil geblieben. «Eine Fischfangstatistik zeigt nur, wie viele Fische in welcher Zeit aus der Aare entnommen wurden», betont Gerhard. Rückschlüsse darauf, welche Arten in der Aare vorhanden seien, könne man einer Fischfangstatistik nicht entnehmen, betont er weiter, sie liefere allenfalls Indizien, dass sich die Artenzusammensetzung verschoben haben könne. Der Anteil der wärmeliebenden Arten am Gesamtfang hat sich jedenfalls in den letzten Jahren deutlich erhöht. Wie in allen anderen Flüssen auch werden kaum noch Äschen und Forellen aus der Aare gezogen. Die letzten vorliegenden Zahlen von 2023 zeigen einen Gesamtfang von 6793 Fischen. Fast 80 Prozent davon gehen auf das Konto von drei wärmeliebenden Arten: 3419 Flussbarsche/Egli, 1339 Alet und 609 Welse.
Laichhilfen für Egli
Seit einigen Jahren engagieren sich die Mitglieder des Aarburger Fischereivereins auch als «Geburtshelfer», indem sie mit Steinen befestigte Weihnachtsbäume – dieses Jahr gespendet vom Zofinger Strassenbauunternehmen Aeschlimann AG sowie vom Küngoldinger Landwirt Thomas Widmer – in der Aare versenkten. Sie dienen in erster Linie dem Egli als Laichhilfen, bieten aber auch anderen Fischen Schutz und erhöhen auch die Artenvielfalt von wirbellosen Kleintieren im Gewässer. «Es ist letztlich erfolgsversprechender, naturnahe Strukturen zu schaffen, die der Naturverlaichung dienen», betonte Hansruedi Joss, der bei der «Tannenbaum-Aktion» bei den oberen Aare-Inseln am letzten Samstag als Kapitän im Einsatz stand.

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Der geschäftliche Teil wurde zügig abgewickelt
Region Versammlung des Gemeindeschreibervereins
Nach einem offerierten Apéro wurde der geschäftliche Teil der Versammlung zügig abgewickelt. Das Protokoll und die Jahresrechnung 2024 wurden diskussionslos genehmigt. Im Jahresbericht orientierte die Präsidentin unter anderem über die im Jahr 2024 eher zu kurz gekommenen gemeinsamen Aktivitäten und Christoph Kuster, Gemeindeschreiber Oftringen, gab Informationen aus dem Kantonalverband preis.
Unter dem Traktandum «Ehrungen» durfte die Vorsitzende Felix Fischer, welcher nach 36 Jahren als Gemeindeschreiber der Gemeinde Kölliken für seine Verdienste rund um den Berufsstand, insbesondere im Bereich der Aus- und Weiterbildungen, die Ehrenmitgliedschaft verleihen. Weiter wurde Stephan Niklaus, Gemeindeschreiber Vordemwald, zu seinem 35-jährigen Vereinsjubiläum sowie Christoph Kuster, Gemeindeschreiber Oftringen, zu seinem 20-jährigen Vereinsjubiläum, gratuliert.
Mutationen
Im Berichtsjahr aufgenommen und im Verein herzlich willkommen geheissen werden Miriam Wassmer, seit 1. Juli 2024 Gemeindeschreiberin in Staffelbach; Linda Stadtmann, seit 1. November 2024 Fachspezialistin Kanzlei auf der Stadt Zofingen; Patrick Siegrist, seit 1. Juni 2023 Fachspezialist Kanzlei und Ratssekretär des Einwohnerrates Zofingen und Melanie Fink, seit 1. Juli 2024 Gemeindeschreiber-Stv. in Kölliken.
Ferner durfte der Verein per 1. Januar 2025 Marion Schmid-Gall, welche als Nachfolgerin von Felix Fischer als Gemeindeschreiberin von Kölliken gewählt wurde, wieder in den Verein aufnehmen und ebenfalls herzlich willkommen heissen. Ein Mitglied ist infolge Stellenwechsels aus dem Verein ausgetreten.
Im Anschluss an den offiziellen Teil überbrachten Silvan Bärtschi und Patric Jakob Grussbotschaften, die gespickt waren mit interessanten Details zu den beiden Dörfern Bottenwil und Wiliberg.
Beim anschliessenden Nachtessen wurde lange und eifrig diskutiert, und die Versammlung in geselliger und gemütlicher Runde zum Ausklang gebracht.

Drei neue Firmen – Der Baustart ist offiziell erfolgt
Oftringen Spatenstich auf dem ehemaligen Strabag-Areal
Alois Grüter, CEO des Architekturunternehmens IGD Grüter AG, begrüsste die Anwesenden und richtete zu Beginn einige Dankensworte an diverse Projektbeteiligte. Erstmals involviert wurde die IGD Grüter AG Anfang 2023. «Es ist eine angenehme Zusammenarbeit mit den drei Firmen entstanden. Wir durften nicht nur planen, sondern auch mithelfen und beraten», blickt Alois Grüter zurück und preist zudem den einmaligen Standort des entstehenden Gewerbegebäudes an.
Zu Wort kam auch Oftringens Gemeindeammann Hans¬peter Schläfli. Es sei schon fast ein historischer Spatenstich für die Gemeinde Oftringen, merkte er an. «Als mein Vorgänger 2016 mit der Idee, dieses Stück Land zu kaufen, an den damaligen Gemeinderat trat, wurde er noch ein wenig schräg angeschaut. Er konnte mit seinem Argumentarium jedoch schnell überzeugen. Auch die damaligen Gemeinderäte, die dagegen waren, stehen heute hinter dem Projekt.»
Als Vertreter der neuen Eigentümerschaft «ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte» bedankte sich Thomas Fasel für die angenehme Zusammenarbeit und bisherige Entwicklung. Die neue Eigentümerschaft «ASAA» bezweckt die gemeinschaftliche Anlage und Verwaltung von anvertrauten Vorsorgegeldern verschiedener Vorsorgerichtungen in Immobilien. «Als Stiftung bieten wir institutionellen Anlegern, also hauptsächlich Pensionskassen, mit unseren Anlagegefässen eine ideale Ergänzung zu den bestehenden Immobilieninvestitionen», stellte Thomas Fasel die Eigentümerschaft näher vor.
Thomas Fasel findet unter anderem für die Standortlage, aber auch die Firmen, die sich dort ansiedeln werden, lobende Worte. «Wir haben drei hervorragende Mieter, die alle in ihrem Bereich sehr innovativ und professionell sind. Wir haben im Rahmen der Investmentprüfung allen Mietern einen Besuch an ihren bisherigen Standorten abstatten können und waren begeistert über die Leidenschaft und die Präzision, die vorhanden sind. Das sind Mieter, wie man sie sich wünscht.»
Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis im Sommer beziehungsweise Spätsommer 2027 andauern.

Der Appetit auf Eier ist stark gewachsen
Strengelbach Landwirt Peter Gerhard zum Thema «Eierknappheit»
Ein stattlicher Bauernhof im Strengelbacher Dörfli, der seit mindestens 200 Jahren im Besitz der Familie Gerhard ist. Hier betreibt Peter Gerhard zusammen mit seinem Bruder Jürg einen rund 50 Hektaren grossen, gemischten Ackerbau-Milchwirtschafts-Betrieb mit Hofladen. Im Nebenerwerb verarbeiten die Brüder das Obst ihrer Hochstamm-Obstbäume zu Süssmost. Zudem halten sie Hühner in Freilandhaltung. «Mit 120 Hühnern halten wir in unserem mobilen Hühnerstall allerdings eine eher kleine Hühnerschar», meint Peter Gerhard. So klein die Hühnerschar auch sein mag: Gerhard vermag damit die gesamte Nachfrage des Zofinger Landiladens nach Freilandeiern (ohne Bio-Eier) zu decken. «Und auch für den Direktverkauf im eigenen Hofladen verbleiben noch genügend Eier», sagt der 62-jährige Meisterlandwirt.
Eierknappheit? «Davon ist bei uns momentan nichts zu merken», hält der Strengelbacher Landwirt fest. Er könne feststellen, dass es nach wie vor eine Stammkundschaft sei, die den Hofladen besuche. Anders als etwa während der Corona-Pandemie. Damals waren häufig Neukunden im Laden auszumachen, der Absatz von Eiern schnellte in die Höhe. Dennoch sei auch jetzt nicht vollständig auszuschliessen, meint Gerhard weiter, dass die zunehmende Nachfrage nach Eiern vor Ostern zu einer Verknappung führen könne. «Das ist auch nicht unüblich – vor Ostern erreicht der Eierverkauf alljährlich Höchstwerte», führt Gerhard mit einer gewissen Gelassenheit aus. Er vermute aber, dass vor allem die Grossverteiler eine allfällige Eierknappheit zu spüren bekommen würden.

Bild: Regina Lüthi
Nachfrage zeigt seit Jahren nach oben
Der Appetit auf Eier ist in den letzten Jahren – sieht man von einem Einbruch im Jahr 2022 ab – kontinuierlich gewachsen und erreichte im vergangenen Jahr einen absoluten Höchstwert. Wurden 2016 insgesamt 1495 Mio. Eier konsumiert, so waren es im vergangenen Jahr bereits 1797 Mio. Stück. Anders ausgedrückt: Wer in der Schweiz wohnhaft ist, isst pro Jahr fast 200 Eier. Das sind, wie die Zahlen des Bundesamts für Landwirtschaft zeigen, etwa 25 Eier mehr als noch 2012 durchschnittlich konsumiert wurden. Im internationalen Vergleich erreicht der Pro-Kopf-Verbrauch von Eiern in der Schweiz allerdings keine Spitzenwerte. Mexiko ist mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 409 Eiern (Zahlen von 2021) Leader in dieser etwas speziellen Rangliste, aber auch in den USA oder in umliegenden Ländern in Europa verbrauchen Konsumentinnen und Konsumenten deutlich mehr Eier als Herr und Frau Schweizer.
Der steigende Appetit auf Eier dürfte mehrere Gründe haben. «Das Ei ist ein günstiges Produkt», hält der Strengelbacher Landwirt fest. Zudem sind sie proteinreich, enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe und wirken auch sättigend. Und all dies bei gerade einmal siebzig Kalorien pro Ei. Auch die Sorge vor zu viel Cholesterin hat sich in Fachkreisen als unbegründet erwiesen. Ausserdem haben sich auch die Ernährungsgewohnheiten verändert. «Das Ei ist eine günstige und gute Alternative für all jene Menschen, welche weniger oder gar kein Fleisch mehr essen wollen», meint Peter Gerhard.
Inländische Produktion erhöht
Auf die erhöhte Nachfrage haben die Schweizer Landwirte mit einer Erhöhung der Produktion reagiert. Lag der Anteil an Schweizer Eiern 2012 noch bei 54 Prozent, so erreichte er 2022 mit über 68 Prozent seinen vorläufig höchsten Anteil. Seit Herbst 2024 übersteigt die Nachfrage die Produktion von Schweizer Eiern, wie GalloSuisse, die Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten, mitteilte. Der Mangel, der sich hauptsächlich bei Freilandeiern bemerkbar machte, wurde vermehrt mit dem Import von Eiern ausgeglichen. Das ist der Hauptgrund dafür, dass der inländische Anteil an der Eierproduktion im vergangenen Jahr auf 62,5 Prozent sank. Allerdings sind auch den Importen Grenzen gesetzt, denn auch anderswo in Europa und speziell in Amerika, wo seit drei Jahren die Vogelgrippe grassiert, lässt sich eine gestiegene Nachfrage nach Eiern beobachten. In Amerika spricht man sogar von einer «Eggflation», einer Wortschöpfung von «Ei» und «Inflation» – haben sich doch die Preise für Eier in kurzer Zeit vervierfacht! Eine derartige Erhöhung der Eierpreise ist in der Schweiz übrigens nicht möglich, da hierzulande Jahrespreise fixiert sind.
Kurzfristige Lösungen, um die inländische Produktion zu erhöhen, gibt es nicht. «Du kannst nicht von heute auf morgen mehr Eier produzieren», hält Peter Gerhard fest. In der Brüterei dauert der Weg vom Brutei bis zum Küken rund 22 Tage, im Alter von 18 Wochen beginnen die Hühner mit dem Eierlegen, dann dauert es nochmals vier Wochen, bis sie grosse Eier legen. «Damit sind wir bereits bei einer Vorlaufzeit von einem halben Jahr», hält Gerhard fest. Und dann allenfalls Überschüsse für die Zeit nach Ostern zu produzieren, mache schlussendlich auch keinen Sinn. Deshalb könnte es durchaus passieren, dass die Eierregale vor Ostern nicht prall gefüllt sein könnten, meint Peter Gerhard. In dem Sinn, dass nicht alle Arten von Eiern durchgehend erhältlich sein werden. «Die grosse Ostereier-‹Tütschete› wird in den Schweizer Stuben aber stattfinden», zeigt sich Gerhard überzeugt. Erfahrungsgemäss werde die Eiernachfrage nach Ostern noch einige Zeit hoch bleiben und der Absatz erst im Sommer zurückgehen.

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Kulinarische Genüsse und eine wunderbare Gelegenheit für den Austausch
Reiden Der Samariterverein Langnau und Umgebung lud zum Sonntagsbrunch
Am vergangenen Sonntag hatten die fleissigen Mitglieder des Samaritervereins Langnau und Umgebung wahrlich alle Hände voll zu tun. Der traditionelle Brunch im Pfarreisaal ist ein beliebter Treffpunkt im Frühling, um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. «Wir haben in diesem Jahr mehr Tische aufgestellt und können 100 Gäste bewirten», erzählt Jörg von Rohr, der haufenweise hausgemachte Rösti mit Spiegelei serviert.
Der Ansturm erfolgte bereits mit der Türöffnung um 9 Uhr. Der Saal war schnell voll und das Büfett leerte sich zügig. Die Samariter sorgten fleissig für Nachschub und brachten Platten mit Aufschnitt und Käse, füllten Konfitüre, diverse Brotsorten und Getränke auf. Zopf und Brot waren ebenso selbst gemacht wie das Birchermüsli. Kaffee, Tee und Kakao wurden am Tisch serviert und nachgefüllt.
Neben dem kulinarischen Genuss stand der Sonntagsbrunch auch ganz im Zeichen des gegenseitigen Austauschs. Im Pfarreisaal herrschte eine fröhliche, familiäre Atmosphäre und ein reges Kommen und Gehen. Freie Stühle gab es keine mehr – aber die Gäste warteten gerne, bis die einen oder anderen satt und zufrieden den Saal verliessen.

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi