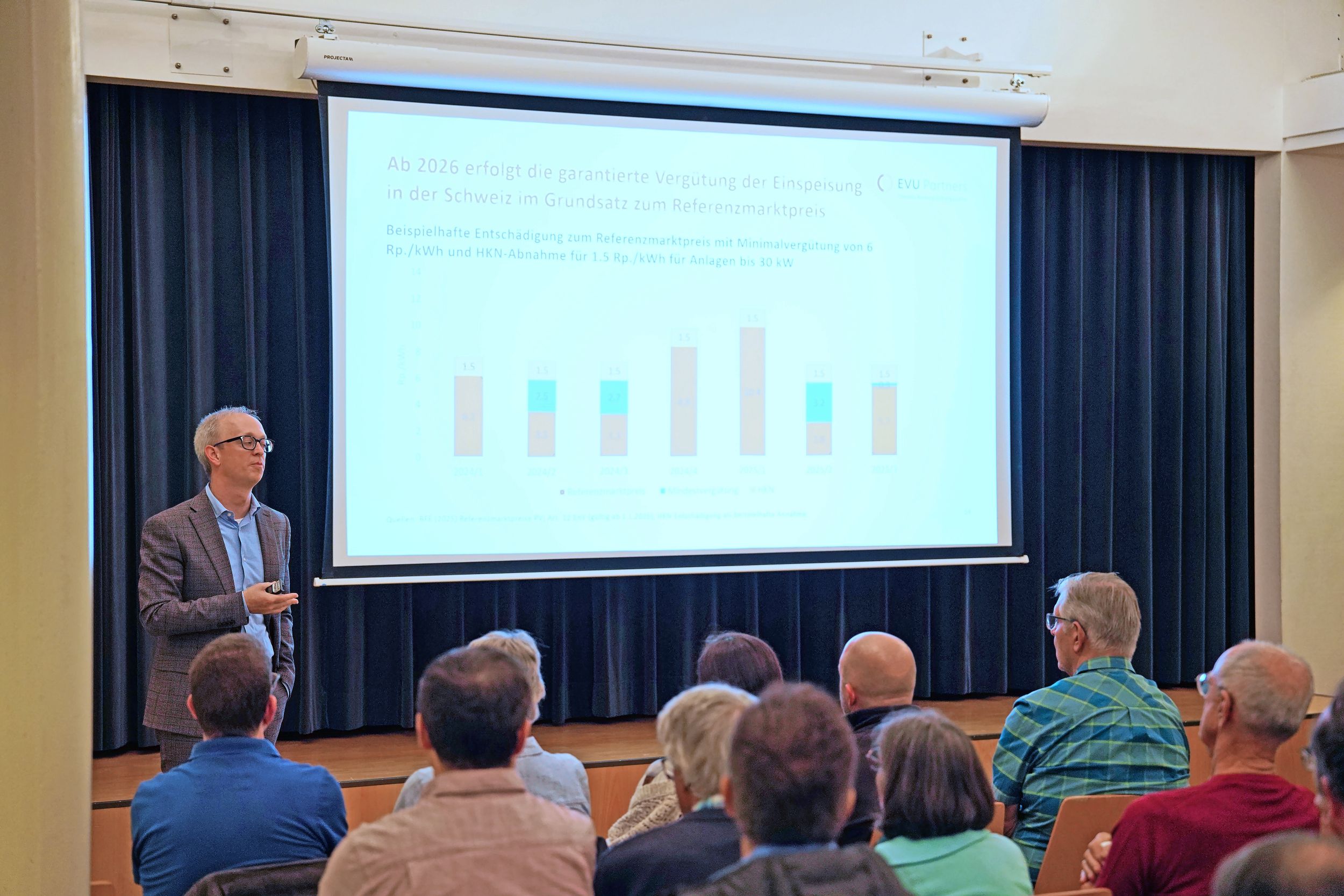Gemeinsam geniessen – gemeinsam Gutes tun
Oftringen Das traditionelle Clientis-Zmorge lockte fast 240 Personen an
Es ist ein Fixpunkt im Oftringer Dorfleben – das Clientis-Zmorge. Das war auch am vergangenen Sonntag so. Schon früh strömten die Leute auf das Bankgebäude an der «Chrüzi» zu. Die Bänke im Zelt waren im Nu sehr gut besetzt, zusätzlich mussten auch im Freien noch weitere Bänke aufgestellt werden. Schlussendlich erreichte die Besucherzahl eindrückliche 238 Personen.

Bild: Thomas Fürst
Die Gäste durften sich am grosszügigen Buffet selbst bedienen. Feine Züpfe und Brote, Käse- und Fleischplatten, Früchte und Birchermüesli, Butter und diverse Konfitüren, Speckrösti – das Angebot liess absolut keine Wünsche offen. Für umgehenden Nachschub am Buffet war das Team der Rothrister Metzgerei Kohler besorgt, während Zweier-Teams von Mitarbeitenden der Clientis Sparkasse Oftringen stets mit Kaffee und Milch zwischen den Bänken zirkulierten. Unterhalten wurden die Gäste mit lüpfiger Musik vom «Örgeliplausch Muttenz».

Bild: Thomas Fürst
Erlös für einen guten Zweck
Nicht nur mit der grossen Besucherzahl zeigte sich Daniel Studer, Bankleiter der Clientis Sparkasse Oftringen, zufrieden. Er freute sich auch über «den freiwilligen und äusserst motivierten Einsatz» seines Teams, das vollständig vor Ort im Einsatz war.
Die Clientis Sparkasse Oftringen übernimmt wie immer die gesamten Kosten des «Zmorge», während der gesamte Erlös einer sozialen Institution in der Region gespendet wird. In den Genuss des Checks wird dieses Jahr die Kiss Genossenschaft Wiggertal kommen. Kiss bietet begleitete Nachbarschaftshilfe in Oftringen und Umgebung an.

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Vorhang auf für ein weiteres Kultur-Feuerwerk
Oftringen Vorverkauf von «Kultur in Oftringen» startet am 1. September
«Das Publikum schätzt den eingeschlagenen Kurs offensichtlich», sagt Jürg Hunziker. Hunziker ist als Präsident der Kulturkommission Oftringen für die Programmgestaltung von «Kultur in Oftringen» zuständig. In der letzten Saison konnte die Auslastung erneut gesteigert werden, eine Veranstaltung war sogar restlos ausverkauft. «Das haben wir bis anhin noch nie erreicht», freut sich der diplomierte Architekt über die positive Entwicklung.
Nun liegt das Programm der Saison 2025/26 vor. Ein bewusst vielfältig gestaltetes Programm, das für jeden Geschmack etwas bietet. Dabei wurde die bewährte Mischung aus Comedy, Kabarett, Theater und Musik bewusst beigehalten, aber auch ergänzt mit neuen Facetten aus Magie und Musical-Comedy.
Zauberhafte Magie zum Auftakt
Und mit zauberhafter Magie geht´s gleich zum Auftakt am Donnerstag, 18. September los. Da steht einer auf der Bühne, verwandelt Papier in endlos viele Geldscheine, erweckt Polaroid-Fotos zum Leben, kreiert mit zwei Lichtstäben eine spektakuläre Lichtershow und schwebt am Ende einer genialen Show einfach in einer Seifenblase davon. Mellow heisst der sympathische Magier, der im Kapuzenpulli auf der Bühne steht, und vielfach ausgezeichnet ist. «Was ist echt, was ist Illusion? Diese Frage wird sich das Publikum unweigerlich stellen», schmunzelt Hunziker. Die Show des deutschen Meisters der Zauberkunst wird diese Frage offen lassen – verzaubern wird sie das Publikum allemal.

Bild: zvg / Mellow
Aufwühlende Dramatik und launige Gauner-Komödie
Weniger leicht, eher dramatisch und manchmal sogar beklemmend wird es am 23. Oktober auf der Bühne zugehen, wenn das Gerichtsdrama «Terror» gespielt wird. Das aufwühlende Stück von Ferdinand von Schirach kreist um die brisante Frage, ob ein Kampfjetpilot schuldig gesprochen werden soll, nachdem er wider Befehl ein entführtes Passagierflugzeug abgeschossen hat, um 70´000 Menschen in einem Stadion das Leben zu retten. Dabei wird das Publikum am Schluss in die Urteilsfindung miteinbezogen.
Ein wenig Krimi, ein wenig Komödie – das ist «Ladykillers», gespielt vom Berliner Kriminal Theater. Das perfekt geplante Verbrechen hat ein angebliches Streichquartett geplant, das sich bei der gutherzigen Witwe Mrs. Wilberforce ein Zimmer gemietet hat, um in aller Ruhe üben zu können. Am perfekt geplanten Verbrechen sind bekanntlich schon viele gescheitert – als die Wahrheit im Stück ans Licht kommt, eskaliert das Chaos. Doch wer kann schon einer netten alten Dame etwas antun? «Ein herrlicher Krimi, unterlegt mit viel schwarzem Humor, bei dem man herzhaft lachen kann, auch wenn alles schiefgeht», freut sich Jürg Hunziker auf die Aufführung vom 6. November.
King Elvis kehrt zurück
Mit grossen Schritten geht es auf den Jahreswechsel zu, doch vorher kehrt der King of Rock´n´Roll auf die Bühne zurück. Am 4. Dezember erwartet das Publikum ein erstes musikalisches Highlight mit «Elvis lebt!». Der Walliser Sänger, Schauspieler und Kabarettist Diego Valsecchi zeigt in Oftringen – begleitet von zwei SängerInnen sowie Liveband – seinen ganz eigenen Elvis.
Exfreundinnen mit neuem Programm
Endlich: Der langersehnte Film der Exfreundinnen steht kurz vor Drehstart. Doch der Produzent hat sich mit dem Geld auf die Bahamas abgesetzt. In dieser Situation erfinden sich die Superheldinnen auf der Stelle neu – und entfachen ein fulminantes Feuerwerk an Comedy, wie man es von ihrem letzten Auftritt in Oftringen bereits kennt. Mit diesem Highlight startet das Programm von «Kultur in Oftringen» am 15. Januar 2026 ins neue Jahr.
Ausgerechnet: Am Tag, als in der Kneipe um die Ecke ein besonderes Jubiläum gefeiert werden soll, gibt die Jukebox den Geist auf. Kein Problem – die Crew dieser einzigartigen Kneipe macht die Musik halt selbst. «Jukebox Heroes» heisst die neuste Musik-Show, die Regisseur Dominik Flaschka zusammen mit dem Ensemble der «Shake Company» entwickelt hat und die einen wilden und doch stimmigen Mix aus den verschiedensten musikalischen Genres vereint. Von Deutsch-Rap über Latinoklänge und Eighties-Pop-Rock bis hin zu Schweizer Klassikern ist alles dabei. Und mit Fabienne Louves und Gigi Moto zwei ganz starke Frauenstimmen. «Ein wunderbarer Abend für ein breites Publikum», ist sich Jürg Hunziker sicher, man sollte sich den 19. Februar 2026 dick anstreichen in der Agenda.
Scharfsinnige Analysen der Arbeitswelt
Lustig, bissig, böse und scharfsinnig ist Fabian Unteregger mit seinem neuen Programm zurück auf der Bühne. Auch in «Fachkräftemangel» schickt er seine Lieblingsfiguren ans Rednerpult und lässt sie darüber sinnieren, wieso Menschen im Bundesrat Departemente leiten, für die sie nicht ausgebildet sind oder warum der Schulunterricht auf lange Sicht auf Youtube-Tutorials umgestellt werden muss. Mit seinem neuen Programm kommt der Comedian, der übrigens Ausbildungen als Lebensmittelingenieur und Arzt abgeschlossen hat, am 12. März 2026 nach Oftringen.
Zum Abschluss trifft Musical auf Comedy
Und bereits steht das Saisonfinale vor der Tür, wenn es am 23. April 2026 heisst: «Am Broadway ist die Hölle los». Auf der Bühne steht das falsche Bühnenbild – jetzt liegt es an den Bühnenarbeitern, den Abend zu retten. Nicht umsonst heisst es ja: The show must go on. Die Stand-up-Comedians, allesamt gefeierte Solisten des renommierten Bonner «Springmaus»-Theaters, schlüpfen in die Rollen der Bühnencrew und führen mit viel Witz durch die grössten Musical-Hits. «Wunderbare Stimmen, bunte Kostüme und eine spielfreudige Band – bestehend aus Musikern der Kölner Philharmonikern – werden das Publikum durch einen unbeschwerten und vergnüglichen Abend begleiten», meint Jürg Hunziker.
Vorverkauf startet am 1. September
Sämtliche Vorstellungen finden jeweils donnerstags um 20 Uhr im grossen Saal des you event centers statt. Dank treuen Sponsoren konnten die Preise ein weiteres Jahr unverändert belassen werden. So kostet ein Saisonabo für sämtliche acht Vorstellungen weiterhin 260, mit den Kulturprozent-Gutschein der Migros Aare sogar nur 240 Franken. Einzeltickets sind für 45 Franken erhältlich, Lernende und Studierende erhalten 50 Prozent Rabatt. Der Vorverkauf startet am 1. September über die Homepage www.kultur-oftringen.ch oder telefonisch über die Gemeindekanzlei Oftringen, Telefon 062 789 82 00.

Bild: zvg / Shake Company

Gemütliches Beisammensein bei Grilladen, Spielen und Musik
Brittnau Die Naturfreunde luden zu ihrem traditionellen Hüttlifest ein
So auch wieder am vergangenen Sonntag. Vor dem traditionellen Gottesdienst spielten die Alphornbläser Chastenblick auf. Später sorgte die Big Band Stadtmusik Aarburg für die Unterhaltung der Gäste. Im lauschigen Wald und im Schatten der Bäume liess es sich gut aushalten. In der idyllischen und gemütlichen Atmosphäre rund um das Naturfreundehaus Fröschengülle wehte der Duft der verschiedenen Grilladen über den Platz.
Die Naturfreunde sorgten mit ihrer Erfahrung tadellos für ihre Gäste. Nachschub war immer gewährleistet und niemand musste lange anstehen. Fleisch, Würste und Salate gingen weg wie frisch geschnitten Brot. Kaffee und Kuchen rundeten das Angebot ab.
Im Wald gab es einen kreativ gestalteten Spiele-Parcours für die Kinder. So wurde das Hüttlifest der Naturfreunde Brittnau erneut ein Treffpunkt für alle, die gemütliche Feste unter freiem Himmel lieben.

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi

Bild: zvg

Bild: Patrick Lüthi

Die Alphornbläser genossen das Fest. – Bild: Patrick Lüthi 
Fleissig wurde das Geschirr abgewaschen. – Bild: Patrick Lüthi 
Gemütliche Atmosphäre und anregende Gespräche. – Bild: Patrick Lüthi

Ein unvergessliches Abenteuer auf Aare, See und Schleusen
Murgenthal Murgenthaler Pontoniere auf grosser Fahrt
Am Donnerstagabend versammelten sich die Pontoniere aus Murgenthal – schwer bepackt mit Ausrüstung, voller Vorfreude und begleitet von den Motorfahrern – zur grossen Fahrt in Richtung Meiringen. Im Gepäck: vier Pontonierboote, wetterfeste Kleidung, Verpflegung und der Wille, ein aussergewöhnliches Wochenende gemeinsam auf dem Wasser zu erleben.
Start auf der Aare – durch die Schlucht ins Abenteuer
Am Freitagmorgen, nur wenige hundert Meter unterhalb der beeindruckenden Aareschlucht, wurden die Boote zu Wasser gelassen. Der Wasserstand war optimal – die Strömung trug die Boote in rasanter Fahrt in den Brienzersee. Dort wurden die Motoren angeworfen und der See in Formation überquert. Die Kulisse: majestätische Berge, glitzerndes Wasser – ein Bild wie aus dem Bilderbuch. Am anderen Seeufer wurden die Boote wieder an Land gezogen, verladen und nach Thun gebracht. Dort erfolgte der nächste Wassergang. Doch bevor es weiterging, wartete ein kulturelles Highlight auf die Kameraden: Eine spannende Stadtführung durch Thun, reich an Geschichte und überraschenden Einblicken.
Durch die Uttigerschwelle – mit Können und Kameradschaft
Die Weiterfahrt Richtung Bern hielt gleich das nächste Abenteuer bereit: die Überfahrt der Uttigerschwelle. Eine Herausforderung, die von den erfahrenen Pontonieren mit Bravour gemeistert wurde. Danach: freie Fahrt, begleitet von hunderten Aareböötlern, Schwimmern und Sonnenhungrigen – ein Volksfest auf dem Wasser. In Bern angekommen wurde gemeinsam gegessen und die Unterkunft bezogen. Doch ans Ausruhen war noch nicht zu denken – die Fahrt war noch lange nicht zu Ende.
Wilde Wasser, feiner Wein und eine Stadt mit Charme
Der Samstagmorgen begann mit einem ordentlichen Adrenalinschub: das Schwellenmätteli gleich nach dem Start forderte den Mut und die Technik der Pontoniere. Doch gut vorbereitet meisterten sie auch dieses Hindernis souverän. Danach folgte ein naturbelassener Abschnitt der Aare – Ruhe, grüne Ufer, Wasservögel – ein Kontrastprogramm, das alle genossen. Doch die Fahrt forderte weiterhin Konzentration: Mehrere Wehre mussten passiert werden, bevor die Truppe schliesslich in Twann ankam. Bei schönstem Wetter wartete dort eine genussvolle Weindegustation – ein wohlverdienter Halt, den niemand so schnell vergessen wird.
Am späten Nachmittag ging es weiter: In Port wurde die Schleuse passiert, danach trugen Wind und Wasser die Boote nach Solothurn. Dort wurde gemeinsam gegessen und mit einem Schlummertrunk auf den erlebnisreichen Tag angestossen.
Heimfahrt mit Grill und guter Laune
Am Sonntag folgte schliesslich die Rückfahrt nach Murgenthal. In Wangen an der Aare legten die Pontoniere nochmals an – Zeit für ein ausgiebiges Grillieren in geselliger Runde, bevor die letzte Etappe in Angriff genommen wurde. Am Nachmittag war es geschafft: Die Pontoniere kehrten zurück nach Murgenthal – erschöpft, aber überglücklich. Was für ein Abenteuer! Drei Tage voller Herausforderungen, Kameradschaft, Natur und Genuss.
Keine Pause – die Saison geht weiter
Doch Ausruhen ist (noch) nicht angesagt: Schon nächste Woche steht das Wettfahren bei den Freunden in Ligerz an – und Anfang September (5. – 7. September) folgt das traditionelle Fischessen der Pontoniere Murgenthal. Alle sind herzlich eingeladen!

Bild: zvg

Das neue Chi Rho stiess auf grosses Interesse
Zofingen Neueröffnung des katholischen Pfarreizentrums
Nach einer Bauzeit von rund 18 Monaten war es am vergangenen Samstag so weit. Die römisch-katholische Kirchenpflege konnte nach der umfassenden Erneuerung zur Besichtigung ihres Pfarreizentrums einladen. Der Präsident der Kirchenpflege, Silvio Bucher, konnte bei der offiziellen Eröffnung eine grosse Anzahl Interessierter willkommen heissen, darunter auch eine dreiköpfige Delegation des Zofinger Stadtrats, Vertreter weiterer Kirchgemeinden und christlicher Gemeinschaften, aber auch Bauunternehmer sowie Architektenvertreter. Bucher zeigte sich erfreut über den gelungenen Umbau und bedankte sich entsprechend bei allen am Umbau Beteiligten.
Mit dem symbolischen Durchschneiden eines roten Bands gaben Co-Gemeindeleiterin Doris Hagi Maier und Silvio Bucher den Weg in die neuen Räume für alle Gäste frei. Nach einem Apéro im grossen, wunderbar renovierten Saal wurden auch die übrigen Räume im Pfarreizentrum besichtigt. Der Tenor unter den Gästen war dabei einhellig: Das Chi Rho ist schön geworden – in den Räumen mit den grossen Fenstern lässt es sich wunderbar verweilen.
Nach der offiziellen Eröffnung liess es sich noch lange im Chi Rho verweilen, gab es doch diverse Verpflegungsmöglichkeiten, eine Kaffeestube, die von den Mitgliedern des katholischen Kirchenchors geführt wurde sowie ein grosses Spielangebot für Kinder und Jugendliche. Ein weiterer Eckpunkt der würdigen Einweihung, war der Gottesdienst mit Segnung.

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Nach der kurzen Ansprache strömten Besucherinnen und Besucher ins Chi Rho. – Bild: Thomas Fürst 
Das Chi Rho verfügt nun auch über eine grosszügige Küche mit professioneller Ausstattung. – Bild: Thomas Fürst 
Der Kirchenchor betrieb die Kaffeestube. – Bild: Thomas Fürst

Käfer-Kult: kleines Museum rollt grosse Geschichte auf
Aarburg Vor zehn Jahren wurde das VW Käfer-Museum eröffnet
Schön aufgereiht stehen sie da. Im Museum, das vor ziemlich genau zehn Jahren, am 15. August 2015 eröffnet wurde. 15 VW Käfer, die der in Aarburg aufgewachsene Journalist und Buchautor Hans Peter Nething zusammengetragen hatte. Die Käfer mit Jahrgängen zwischen 1950 und 1974 dokumentieren die Entwicklungsgeschichte des bis Juli 2003 meist verkauften Automobils der Welt anschaulich. «Jedes Mal, wenn der Hersteller eine bedeutende Neuerung am Käfer vorgenommen hatte, kaufte Hans Peter Nething ein Exemplar», weiss Roland Schmid, der 75-jährige Konservator, der zugleich Vizepräsident des Vereins VW-Käfer-Museum Aarburg ist. Doch nicht nur das. Auch die wechselvolle Geschichte des Museums selber ist dokumentiert. Denn es stiess in Aarburg nicht unbedingt auf Gegenliebe. «Alte Käfer fürs Volk: Lust oder Last?», titelte Redaktorin Nora Bader im Zofinger Tagblatt vom 10. April 2014.
Worum ging es damals? Der im Juli 2013 verstorbene Hans Peter Nething hatte seine Privatsammlung als Schenkung der Gemeinde Aarburg vermacht. Diese beabsichtigte die Einrichtung eines Museums im Untergeschoss der Höhe-Turnhalle – doch dafür hätte die Luftdruckschiessanlage der Aarburger Schützenvereine weichen müssen. Zwar bewilligte die Gemeindeversammlung vom November 2013 einen jährlich wiederkehrenden Unterhaltsbeitrag von 10´500 Franken, doch wurde gegen diesen Beschluss erfolgreich das Referendum ergriffen. Im Mai 2014 sagte das Aarburger Stimmvolk mit 74 Prozent wuchtig Nein zum VW Käfer-Museum.
Wie weiter? Die Käfer wurden nach der verlorenen Abstimmung in die neu gegründete Nething-Roth-Stiftung überführt, deren Präsidium Elsbeth Märchy übernahm. Der Gemeinderat entschied in der Folge, dass die Käfer im Untergeschoss der Höhe-Turnhalle bleiben durften. Eine Betreuergruppe unter der Leitung von Heiny Volkart nahm sich in der Folge der Renovation der Räumlichkeiten, der Finanzierung des Museums und nicht zuletzt der Restauration der 15 Fahrzeuge an. Ende gut, alles gut? «Jein», sagt Roland Schmid, «wir haben jetzt ein Museum, das wir zeigen dürfen, aber die Finanzen sind ein Dauerthema geblieben – wir leben auch heute noch von der Hand in den Mund».
Die Idee eines Kleinwagens hatte mehrere Väter
«Was möchten Sie lieber hören? Die in Deutschland lange hochgehaltene, ‹offizielle› Geschichte des Käfers – oder die tatsächliche?». Diese Frage stelle er seinen Gästen zu Beginn jeder Führung, führt Roland Schmid aus. Schmid hat sich seit der Museums-Eröffnung in die VW-Geschichte vertieft und sich ein enormes Wissen angeeignet. Also, die offizielle Geschichte in Kurzfassung: Ferdinand Porsche war, beauftragt und gefördert von Adolf Hitler, der Erfinder des Volkswagens, des späteren VW Käfers.
An der Idee, einen Kleinwagen zu entwickeln, der das Auto zu einem Massenprodukt machen würde, haben bereits in den 1920-er-Jahren zahlreiche Pioniere getüftelt. Zum Beispiel Béla Barényi, der bereits 1925 eine Skizze vorlegte, die dem späteren Käfer auffallend ähnlich sah. Oder Hans Ledwinka, Konstrukteur des Tatra V 570. Oder Josef Ganz mit seinem Standard Superior 1930, der mit einem konkurrenzlos günstigen Preis von 1590 Reichsmark als «schnellster und billigster deutscher Volkswagen» angepriesen wurde. Und natürlich auch Ferdinand Porsche, der 1936 einen Prototyp, den Typ V60, vorlegte. «Die Idee eines Kleinwagens hatte sicherlich mehrere geistige Väter», betont Roland Schmid. Aber Porsche habe sie, «mit einer Armada von Ingenieuren um sich, auf Geheiss Hitlers und im Auftrag des Reichsverbands der Deutschen Automobilindustrie», wie Schmid sagt, schliesslich in die Realität umgesetzt.
1938 ging es dann richtig los. Die Grundsteinlegung für das Volkswagenwerk erfolgte am 26. Mai bei Fallersleben (heute ein Stadtteil von Wolfsburg). Und dann begann der 2. Weltkrieg. Die Produktion des KDF-Wagens (Kraft durch Freude), wie der Käfer damals hiess, war zu Ende, bevor sie richtig begonnen hatte. Während des Krieges wurden in Wolfsburg Kriegs-Fahrzeuge wie der Kübel- oder der Schwimmwagen gebaut.
Erfolgsgeschichte beginnt nach dem Krieg
Nach dem Krieg war das Volkswagenwerk zu zwei Dritteln zerbombt – und die Alliierten hatten die Devise ausgegeben, möglichst viele Industriebauten und Anlagen rückzubauen. Auch in Wolfsburg. Den Auftrag, die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen, bekam ein junger englischer Offizier, Ivan Hirst. Hirst sah das Elend der noch dort lebenden Menschen, meist Zwangsarbeiter. Der ausgebildete Ingenieur erkannte aber auch, dass es relativ schnell möglich wäre, in Wolfsburg wieder Autos zu produzieren. Er überzeugte seine Vorgesetzten, Fahrzeuge zu produzieren, die den Besatzern dienen konnten, sich in einem weitgehend zerbombten Land bewegen zu können. So wurden 2000 Käfer auf dem Chassis des Kübelwagens und aus Teilen des ehemaligen 1938-er-KDF produziert. «Ein Engländer darf also mit Fug und Recht als Retter für das Weiterbestehen des VW Käfers und der Volkswagenwerke nach dem Krieg bezeichnet werden», betont der Konservator des Aarburger VW-Käfer-Museums.
Der Rest ist Geschichte. Der Käfer wurde zum geläufigsten Symbol des deutschen Wirtschaftswunders. 1965 läuft in Wolfsburg der zehnmillionste Käfer vom Band. Am Schluss sind es exakt 21´529´464 VW Käfer, die zwischen 1938 und 2003 produziert wurden. Bis Juli 2003 ist der Käfer das meistverkaufte Auto der Welt, dann wird er vom VW Golf abgelöst.
Seit April 1948 auch in der Schweiz
Im April 1948 kamen die ersten 26 Käfer auch in die Schweiz. «26 Werksfahrer brachten die Käfer an die Schweizer Grenze», weiss Roland Schmid. Am Zollamt Lörrach / Riehen erfolgte die Verzollung und anschliessend wurden die Käfer gegen Barzahlung direkt an die Händler ausgeliefert. Am Schluss waren es rund 1,7 Millionen Käfer, die in die Schweiz importiert wurden.
15 ausgewählte Exemplare können im kleinen, aber feinen Aarburger VW Käfer-Museum besichtigt werden. Darunter auch das seltene Hebmüller-Cabrio von 1950, von dem auf Grund eines Grossbrands in der Karrosserie Hebmüller Söhne nur 696 statt der geplanten 2000 Fahrzeuge produziert wurden. Heute gibt es noch rund 180 Stück des Kultobjekts.
Das VW Käfer-Museum ist regelmässig am ersten Sonntag im Monat von 10.30 Uhr bis 12 Uhr offen – das nächste Mal am Sonntag, 7. September. Der Eintritt ist gratis. Führungen für Vereine, Firmen und Gruppen sind auf Vereinbarung gegen eine kleine Entschädigung möglich. Anfragen sind zu richten an vwkaefermuseum@gmail.com.

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

An der gut besuchten Museumseröffnung vom 15. August 2015 wurde angeregt diskutiert. Ganz rechts Heiny Volkart, Leiter der Betreuungsgruppe. – Bild: zvg

Das 1974-er-Modell des Käfers ist das jüngste Modell der Sammlung und zugleich der letzte Jahrgang, der noch in Wolfsburg gefertigt wurde. – Bild: Thomas Fürst 
Das 1956-er-Modell wurde 1982 von Hans-Peter Nething nach einer aufwendigen Restauration von Karrossserie und Interieur zu neuem Leben erweckt. – Bild: Thomas Fürst 
Die Innenraumausrüstung: Im Vergleich zu heutigen Autos spartanisch, aber stilvoll. – Bild: Thomas Fürst 
Das Wolfsburg-Emblem, das bei allen Käfern bis und mit 1962 auf der Motorhaube prangte. – Bild: Thomas Fürst

Gelebte Tradition – das Risotto-Essen bringt mehr als das ganze Dorf zusammen
Wynau Der Klub Kochender Männer sorgte wieder für Gaumenfreuden
Der Klub Kochender Männer lädt seit etlichen Jahren immer im August die Bevölkerung zum Risotto-Essen. Das beliebte Pilz-Gericht wird in grossen Militärkesseln zubereitet. «Rund 360 Portionen werden es sicher», verrät Kurt Jörg, Präsident des Klubs. Nicht verraten wird allerdings das Rezept – das «Risotto al funghi» ist eine Eigenkreation der kochenden Männer. Mit ihren monatlichen Kochabenden haben sich die Herren das nötige Wissen längst erarbeitet und ihr Können schon sehr oft bewiesen. Gerne erinnern sich alle an die legendären Militär-Kässchnitten am Adventsmarkt.
Wer beim Risotto-Essen nicht auf Fleisch verzichten will, kann sich mit Grillschnecke, oder Schweinehaxe mit wunderbarer Sauce kulinarisch verwöhnen lassen. Zahlreiche Helferinnen und Helfer bieten einen fantastischen Service. Bestens gelaunt versorgen sie die Gäste – und vor allem auch schnell. Niemand muss lange warten, Teller um Teller wird über den Platz bei der Lindenhalle getragen. Ein breites Getränke-Angebot, mit und ohne Alkohol, rundet den kulinarischen Teil ab.
In gemütlicher Atmosphäre geniessen alle die üppigen Portionen. Wer nach dem Risotto noch einen Platz im Magen hat, lässt sich mit Dessert in Form von diversen Kuchen verwöhnen. Natürlich gibt es dazu den passenden «Kochkessi-Kafi».
Nach dem Essen lädt die Bar mit zusätzlichem Angebot zum Verweilen und der eine oder andere «Verdouerli» wirkt Wunder – und so kann der Abend dann richtig schön ausklingen.
Das Risotto-Essen der Wynauer Köche ist ein fester Bestandteil im Kalender und erfreut sich weit über die Dorfgrenzen hinaus an grosser Beliebtheit. Jetzt heisst es wieder für ein Jahr warten – bis es im August 2026 hoffentlich wieder soweit ist.

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi

Mit dem Grossprojekt in die Zielgerade eingebogen
Rothrist Offizielle Übernahme der Bornapark-Neubauten
«Heute ist ein besonderer Moment für uns alle», meinte Felix Schönle, Verwaltungsratspräsident der Borna, am Montag bei der offiziellen Übernahme der Neubauten. Das Ziel sei sichtbar, aber noch nicht ganz erreicht.
Vor 31 Monaten wurde der Spatenstich zum Grossprojekt Bornapark vorgenommen. «In den seither vergangenen rund 900 Tagen sind aus Plänen und Visualisierungen Realität geworden», meinte Schönle weiter. Das Gebäude, das heute übernommen werde, sei mehr als nur Beton, Holz, Stahl und Glas. «Es ist ein Ort der Zukunft – ein Raum für Zusammenarbeit, für Leben und Wirken. Diese neuen Bauten schaffen eine freundliche, inspirierende Umgebung, in der man sich wohlfühlt und gerne tätig ist», so der Verwaltungsratspräsident weiter.
Schönle vergass nicht, alle am Bornapark-Projekt Beteiligten seinen verbindlichen Dank auszusprechen – insbesondere dem Architektur-Büro Malte Kloes, dem Büro für Bauökonomie sowie den beteiligten Ingenieuren, Planern und Handwerkern. Namentlich erwähnte er Bauleiter Franz Ineichen, welcher entscheidend zum guten Gelingen und zur hohen Ausführungsqualität des Projekts beigetragen habe, Stefan Müller von der Borna-Geschäftsleitung, der mit grossem Einsatz Koordination und Planung verantwortet habe sowie Thomas Schweizer von Bhend Architektur, der in den letzten Monaten mit seinem Wissen und seiner Erfahrung als Bauherrenvertreter eine grosse Unterstützung gewesen sei.
Mit dem symbolischen Durchschneiden des Bands wurde die offizielle Übergabe der Gebäude vorgenommen und damit den Bewohnenden, Mitarbeitenden und nicht zuletzt der Öffentlichkeit die Türen zum Bornapark geöffnet.

Bild: Thomas Fürst

Als die Post in die Luft ging
Zofingen Die 76. Folge der beliebten Mühlethaler Geschichten
Das Dorf Mühlethal hatte von 1911 bis 2002 eine eigene Post. Das erste Postbüro befand sich auf dem Lindenpass oben, an der heutigen Adresse Hauptstrasse 53. Damals hatte das Haus die Nummer 28. Der Umzug in das zweite Postgebäude geschah 1956, als Werner Roth Posthalter wurde und dabei die Post in sein Haus an der Adresse Dörfli 76 kam (heute Eichhölzliweg 1). Einige Jahre bevor das Posthalterpaar Werner und Klara Roth-Kuhn in Pension ging, begann bei der Post die Suche nach einem neuen Gebäude. Pläne bei der Postautohaltestelle Weiher und in der früheren Gemeindekanzlei scheiterten aber.
Eine Lösung mit der Kirchgemeinde
Erst spät fand die Post eine Lösung mit der der Reformierten Kirchgemeinde, die seit langem Pläne für ein Kirchgemeindehaus hatte. Der grosse Saal im Obergeschoss ist ideal zwischen Schulhausplatz und Friedhof gelegen, der Post stand im gemeinsamen Bau das Untergeschoss zur Verfügung.
Bevor das Posthalterpaar Hansruedi und Kornelia Müller einziehen konnte, musste es drei Jahre lang mit einem 28 Quadratmeter kleinen Provisorium vorliebnehmen. Weil die rote Postbaracke dem Neubau im Weg stand, musste sie zudem einmal zügeln. Ein grosser Pneukran hievte die Baracke vom Parkplatz des späteren Postlokals zum nahen Vorplatz des Bauamtsmagazins im Untergeschoss der Mehrzweckhalle.
Publifax und grosszügige Telefonkabine
Im September 1993 erhielt Mühlethal schliesslich seine dritte und letzte Poststelle mit festem Standort an der Adresse Postweg 5 mit rund 160 Quadratmetern Fläche. «Helle Räume erwarten das Posthalter-Ehepaar und die Kunden», schrieb das Zofinger Tagblatt in seinem Bericht. Der «Publifax mit der Nr. 51 46 00» stand dem Publikum «als Empfangs- und Sendegerät» zur Verfügung, ausserdem eine «grosszügige Telefonkabine». Kornelia und Hans-Rudolf Müller bedienten 300 Haushalte «bei Wind und Wetter», wie es hiess. Kornelia 60 Haushaltungen zu Fuss, Hansruedi mit dem Auto auf 22 Kilometern die restlichen.
Fotos gesucht
Besitzen Sie Fotos oder haben Erinnerungen an das Mühlethal von früher? Die Autoren Christian Roth, Ernst Roth und Bruno Graber sind für weitere Mühlethaler Geschichten und Bildervorträge daran interessiert. Bitte melden Sie sich bei der Redaktion unter Telefon 062 745 93 93 oder E-Mail: redaktion@wiggertaler.ch.

Bild: zvg

Beliebtes Ausflugsziel und Ort der Begegnung
Brittnau 17. August: Hüttlifest der Naturfreunde auf der Fröschengülle
«Hüttli» nennen es die einen, «d´Fröschegülle» die anderen. Damit meinen aber alle das gleiche: Das Brittnauer Naturfreundehaus auf der bekannten Waldlichtung ausser- und oberhalb des Dorfes, umgeben von grosszügiger Wiese mit Spielplatz und Feuerstelle. Das 1954 erstellte «Hüttli» mit seiner idyllischen Umgebung ist beliebtes Ausflugsziel für Wanderer, idealer Spielplatz für Kinder und nicht zuletzt ein toller Ort der Begegnung. Die Geschichte der Naturfreunde und deren Brittnauer Sektion hat ihre Wurzeln lange vor 1954.
Bewegung und Begegnung
«Die Naturfreundebewegung entstand aus der Arbeiterbewegung heraus», weiss Urs Aeschlimann, Präsident der Brittnauer Sektion. Aeschlimann ist «vor 54 Jahren erblich zu den Naturfreunden gekommen», wie er schmunzelnd sagt und kennt die Geschichte der Naturfreunde-Bewegung bestens. Diese wurde 1895 als Touristenverein in Wien gegründet. Ziel war es, die Arbeiterschaft und die Bewohner der nicht privilegierten Aussenquartiere zu Freizeitaktivitäten in der Natur zu bewegen und deren Gesundheit zu fördern. Ausserhalb von Österreich erfolgte die erste Gründung des «Touristenverein die Naturfreunde» in der Schweiz, genauer 1905 in Zürich. Auch im Aargau wurden schon bald erste Sektionen gegründet: 1910 in Baden, 1913 in Aarau, später auch in Brittnau. «In Anbetracht der grossen Begeisterung für den Bergsport, sei es für Sommerbergtouren, Skitouren oder allgemeine, gemütliche Wanderungen, haben sich eine stattliche Anzahl Genossinnen und Genossen zusammengefunden, um eine eigene Sektion zu gründen», hiess es auf einem Flugblatt, mit dem die 22 Initianten, darunter fünf Frauen, zur Teilnahme an der öffentlichen Gründungsversammlung der Naturfreunde Brittnau in den Singsaal des neuen Schulhauses aufforderten. 35 Gründungsmitglieder hoben den Verein am 27. Februar 1937 schliesslich aus der Taufe, Ernst Bienz wurde zum ersten Präsidenten gewählt, der Gasthof zur Sonne zum Versammlungslokal bestimmt. Und der Verein nahm gleich ordentlich Fahrt auf, wie das Jahresprogramm 1938 zeigt. Bis zu drei Anlässe monatlich führte der junge Verein durch: Skitouren, Skikurse, Familienbummel, Velotouren, Badetouren, Filmvorführungen. «Wobei zu bedenken ist, dass Freizeit damals wesentlich knapper bemessen war als heute», bemerkt Urs Aeschlimann, denn damals sei am Samstag zumindest morgens noch gearbeitet worden. Anlässe, die man unter dem Motto «Bewegung und Begegnung» zusammenfassen könnte. Oder wie der ehemalige Präsident der Brittnauer Naturfreunde, Heinz Ott, 2017 in einem Artikel des Zofinger Tagblatts pointiert zitiert wurde: «Die Naturfreunde waren damals eine Art Schweizer Alpenclub für die Arbeiterschicht». Später wurden auch Ferienwochen und eine Waldweihnacht durchgeführt, zudem wurden auch Unterhaltungsabende organisiert. Seit 1980 ist der Verein politisch und konfessionell neutral.
Hüttli ist das Herzstück des Vereins
Spuren hinterliessen die Naturfreunde auch im Storchendorf. In der Sohlenmatt wurde 1951 eine Quelle gefasst und das Naturfreundebrünneli erstellt. Ein Jahr später konnte auf der Fröschengülle eine Reute mit 18 Aren in Pacht genommen werden, auf der eine Spielwiese entstand. Dort kamen die Mitglieder an Sonntagen regelmässig zu Spiel und Geselligkeit zusammen. Doch bald wurde im Verein der Wunsch nach einem Hüttli auf der Fröschengülle laut. In Eigenregie und mittels viel Fronarbeit – eine Liste verzeichnet mehr als 30 Personen mit einem gesamten Arbeitseinsatz von 2058 Stunden – wurde das Hüttli, das zum Herzstück des Vereins wurde, 1954 erstellt und eingeweiht. «Neben der Bevölkerung war auch viel Prominenz vertreten, die Behörde, Delegationen des Landesverbands, des Kantonalverbands und natürlich der befreundeten Sektionen. Am Fahnenmast flatterte das Symbol der Naturfreunde, die Fahne. Mag sie das schöne Werk für alle Zeiten beschützen und den Besuchern Gastfreundschaft, Ruhe und viel Sonnenschein verschaffen», meinte Ernst Bienz in der Festschrift von 1987 zum 50-jährigen Bestehen der Naturfreunde Brittnau zur Hüttli-Einweihung.

Bild: zvg
Das Hüttli war in den ersten Jahren eher spartanisch eingerichtet. «Hatte man Hüttendienst, musste zuerst angefeuert werden, dann musste man mit einer Brente Wasser beim Brünneli holen und dann die Petrollampen anzünden, damit man Licht im Haus hatte», erinnert sich Urs Aeschlimann an längst vergangene Zeiten. Nach und nach modernisierten und erweiterten die Brittnauer Naturfreunde ihr Hüttli. 1959 wurde das Haus unterkellert, 1963 wurde es mit Strom und Wasser versorgt. «Fast 900 Stunden Fronarbeit wurden bei den Arbeiten von 1963 geleistet», sagt Urs Aeschlimann mit Bezug auf ein entsprechendes Dokument, das er im Archiv des Vereins gefunden hat. 1966 konnten die Naturfreunde einen Vertrag mit der Ortsbürgergemeinde Brittnau abschliessen, in dem ein dauerndes Baurecht für das Hüttli erwirkt werden konnte. 1969 wurde der Parkplatz, 1974 der Anbau auf der Südseite und 1978 schliesslich unterirdische WC-Anlagen erstellt.
Naturfreunde verlieren Mitglieder
Die gesellschaftlichen Veränderungen machen auch vor den Naturfreunden nicht Halt. Die Änderungen im Freizeitverhalten führten wie bei vielen anderen Vereinen zu Rückgängen bei den Mitgliederzahlen. Im Aargau mussten einzelne Sektionen sogar ihre Auflösung bekannt geben. Heute gibt es Aargau noch 12 Sektionen mit rund 1400 Mitgliedern.
«Auch bei den Naturfreunden Brittnau ist die grosse Mehrheit im Alter von 60plus», führt Urs Aeschlimann aus. Und der Verein habe auch zunehmend Mühe, den Hüttendienst an Sonntagen – im Hüttli werden jeden Sonntag Suppe, Kuchen und Getränke angeboten – mit eigenen Mitgliedern abzudecken. Dennoch ist Aeschlimann vor der Zukunft nicht bange. «Der Verein zählt über 110 Mitglieder und in letzter Zeit konnten wir etliche jüngere Mitglieder gewinnen», betont der 72-jährige Präsident, der sein Amt gerne in jüngere Hände übergeben würde.
Hüttlifest am 17. August
Jedenfalls konnten die Brittnauer Naturfreunde ihren Beitrag ans kantonale Jubiläum erfolgreich durchführen. Rund 50 Personen nahmen Ende März an einer geführten Exkursion in die einheimische Lurchenwelt teil, die an den nahe gelegenen Fröschengüllenweiher unweit des Naturfreundehüttli führte.
Das zwar traditionelle und doch jedes Jahr besondere Highlight im Jahresprogramm der Brittnauer Naturfreunde steht unmittelbar bevor. Das Hüttli-Fäscht vom Sonntag, 17. August, wartet wie immer mit Livemusik, Kinderprogramm und feinen Grilladen auf. Den Auftakt machen ab 9.30 Uhr die Alphornbläser Chastenblick, um 10 Uhr findet der Hüttligottesdienst der Reformierten Kirche Brittnau statt. Anschliessend Festbetrieb bis 17 Uhr mit musikalischer Unterhaltung durch die Big-Band Stadtmusik Aarburg, ab 13 Uhr Spielparcours für Kinder.

Bild: zvg

Bild: Thomas Fürst

Sinisha Lüscher verhinderte einen Zofinger Doppelsieg
Zofingen 37. Niklaus-Thut-Schwinget mit begeisterndem Schwingsport und neuem Zuschauerrekord
«Im Verein wächst wieder etwas heran», hatte Dinu Anderegg, Präsident des SK Zofingen im Vorfeld des 37. Niklaus-Thut-Schwingets verlauten lassen. Den Worten des Präsidenten liessen die Schwinger am Sonntag Taten folgen. Allen voran Justin Schmid: Mit vier Siegen Adrian Röthlisberger, Simon Friedli, Florian Röthlisberger und Simon Buchmann (Zusatzgang) sowie zwei Gestellten Colin Graber und Gian Tschumper verdiente sich der Strengelbacher erstmals in seiner Karriere die Teilnahme an einem Schlussgang. Dort unterlag er Sinisha Lüscher (SK Olten-Gösgen) in einem ultra-kurzen Kampf mit Kurz und Nachdrücken. Lüscher war am Sonntag mit Siegen in allen sechs Gängen der verdiente Sieger des Niklaus-Thut-Schwingets.

Bild: Thomas Fürst
Ebenfalls zu überzeugen wusste Aaron Rüegger, der sich unmittelbar hinter Justin Schmid auf Rang 3a platzierte. Rüegger zeigte vier Siege, einen Gestellten sowie eine Niederlage gegen Sinisha Lüscher. Eine noch bessere Platzierung vergab Enea Grob mit einer Niederlage im letzten Gang gegen Kaj Hügli. Schlussendlich platzierte sich der Boninger auf Rang 8b. Ansprechend schwangen auch Nicola Häfliger (Rang 13b) und Nick Kulmer (14d) während Sandro Friedli, David Gerber und Mario Kunz wertvolle Erfahrungen sammeln konnten.
Nicht nur von den tollen Leistungen «seiner» Schwinger zeigte sich Dinu Anderegg angetan. «Heute hat einfach alles gestimmt», meinte er: «Schönes Wetter, tolle Atmosphäre, neue Rekordkulisse – einfach ein richtig schönes Schwingfest».
Auch die 159 angetreteten Jungschwinger zeigten attraktiven Schwingsport. Sieger wurden Martin Dummermuth (Jahrgänge 2016/17), Loan Schweizer (2014/15), Damian Bader (2012/13) und Jonas Bühler (2010/11). Beste Zofinger Jungschwinger waren Sven Arnold auf Rang 9a (2014/15), Nick Wyss auf Rang 8 (2012/13) sowie Jamal Eberhard auf Rang 5a (2010/11).

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Enea Grob (SK Zofingen) am Brunnen. – Bild: Thomas Fürst 
Im letzten Kampf gegen Kaj Hügli musste Enea Grob untendurch. – Bild: Thomas Fürst 
Im Kampf gegen Florian Röthlisberger konnte sich Aaron Rüegger (unten) doch noch aus dieser misslichen Lage befreien. – Bild: Thomas Fürst 
Sinisha Lüscher drückt Justin Schmid ins Sägemehl. – Bild: Thomas Fürst 
Soft-Ice war ein gefragter Artikel. – Bild: Thomas Fürst 
Die Küchenmannschaft hatte viel zu tun. – Bild: Thomas Fürst 
Die Alphörndler Reiden sorgten für heimatliche Klänge. – Bild: Thomas Fürst

Schlussgang Jahrgänge 2016/2017: Martin Dummermuth bezwingt Timon Fischer. – Bild: Thomas Fürst 
Sieger Jahrgänge 2014/2015: Loan Schweizer (Basel) mit dem Punktemaximum. – Bild: Thomas Fürst 
Schlussgang Jahrgänge 2012/2013: Damian Bader bezwingt Simon Brunner Minuten mit Kurz-Lätz. – Bild: Thomas Fürst 
Nur fliegen ist schöner: Jonas Bühler hebt Simon Kropf an. – Bild: Thomas Fürst 
Schlussgang Jahrgänge 2010/2011: Jonas Bühler bezwingt Simon Kropf mit Nachdrücken am Boden. – Bild: Thomas Fürst 
Sieger in der ältesten Juniorenkategorie: Jonas Bühler (Herznach). – Bild: Thomas Fürst

Eveline Linggi setzte sich vor Jasmin Gäumann durch
Zofingen Gute Stimmung am 1. Zofinger Frauen- und Meitlischwinget trotz nassem Wetter
Viel Festfreude und eine tolle Atmosphäre trotz misslichen Wetterverhältnissen versprühten die 120 Schwingerinnen, die beim 1. Zofinger Frauen- und Meitlischwinget um die Kränze und Zweige kämpften. Im hochkarätigen Feld der Aktiven legte Eveline Linggi einen beeindruckenden Wettkampf hin. Die Oberartherin gewann ihre ersten fünf Wettkämpfe jeweils mit der Maximalnote. Im Schlussgang gegen die Bernerin Jasmin Gäumann reichte ihr deshalb ein Gestellter, den sie schliesslich mit etwas Glück auch erreichte. Sie krönte sich damit zur ersten Siegerin des Zofinger Frauenschwingets. In den Kranzrängen platzierten sich Jasmin Gäumann, Schwingerkönigin Isabel Egli, Vroni Brun, Mélissa Suchet und als Neukranzerin die Schötzerin Nina Felber.

Bild: Thomas Fürst
Beim Meitlischwinget hiessen die Siegerinnen Audrey Ayer (Meitli 1), Nina Künzi (Meitli 2) sowie Anna Ayer und Rachel Loperetti bei den Zwergli. Die einzige Schwingerin des Schwingklubs Zofingen, Jasmin Keller platzierte sich bei den Meitli1 mit zwei Siegen, einem Gestellten und drei Niederlagen auf dem 12. Rang.
«Wir haben ausschliesslich positive Rückmeldungen erhalten», zog OK-Präsident Dinu Anderegg vom organisierenden Schwingklub Zofingen nach dem Schwinget eine erste Bilanz.

Bild: Thomas Fürst

Der Schlussgang zwischen Eveline Linggi (rechts) und Jasmin Gäumann war hart umkämpft. – Bild: Thomas Fürst 
Jasmin Gäumann will sich ins rettende Aus absetzen. – Bild: Thomas Fürst 
Gestellter Schlussgang bei den Zwergli zwischen Ladina Hartmann (oben) und Svenja Graf. – Bild: Thomas Fürst 
Rachel Loperetti (links) und Anna Ayer erbten den Sieg nach dem gestellten Schlussgang bei den Zwergli. – Bild: Thomas Fürst 
Nina Künzi, Siegerin in der Kategorie Meitli 2. – Bild: Thomas Fürst 
Hart umkämpfter Schlussgang zwischen Blanche Morier und Audrey Ayer bei den Meitli 1. – Bild: Thomas Fürst 
Blanche Morier (hinten) reichte der Sieg im Schlussgang gegen Audrey Ayer nicht zum Schlusssieg. – Bild: Thomas Fürst 
Audrey Ayer siegte bei den Meitli 1. – Bild: Thomas Fürst 
Die Rächeler am verregneten Samstag im Einsatz. – Bild: Thomas Fürst