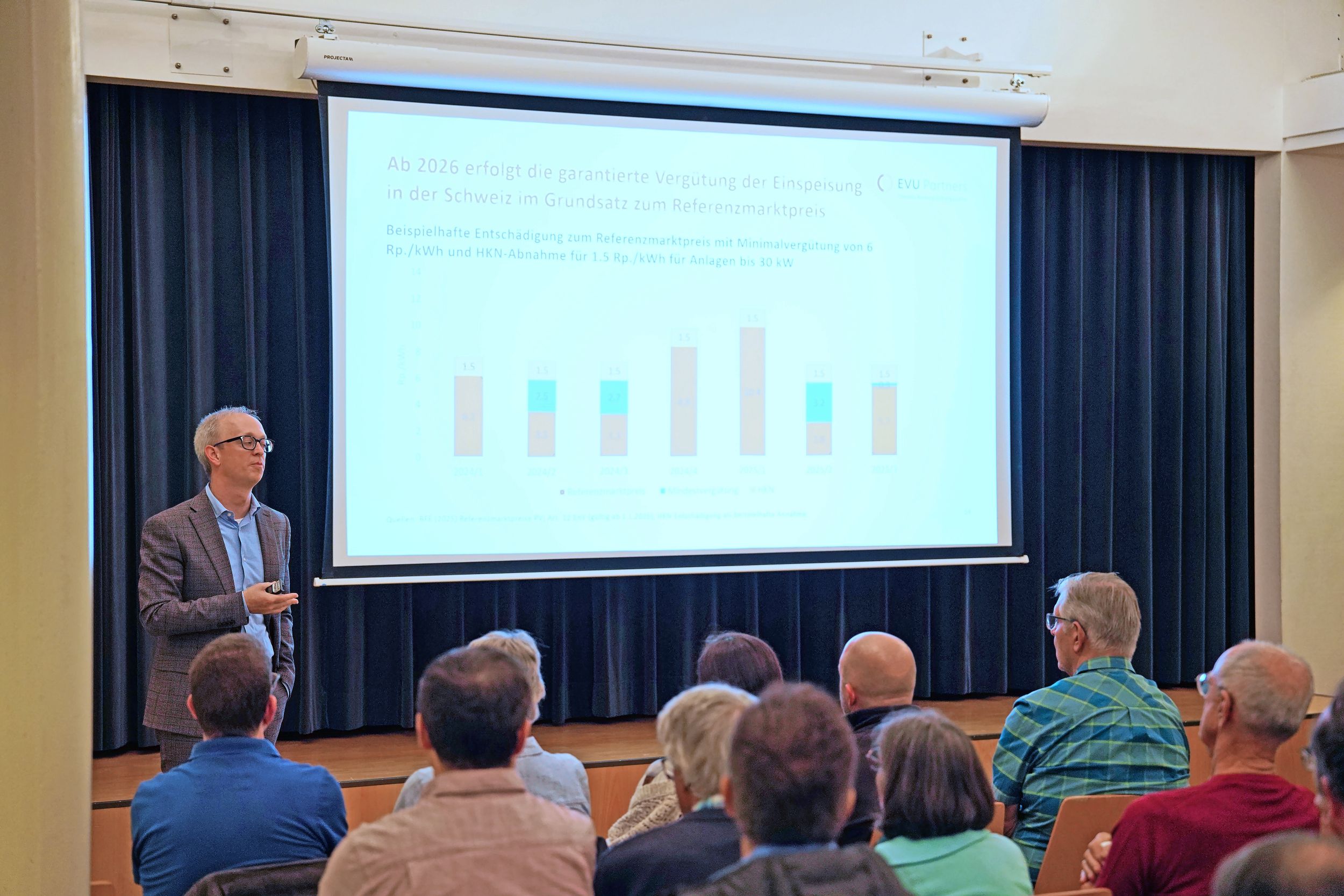Aarburger Party mit Feuergirlanden und Eurodance
Aarburg Tausende zog es ans Strandfest des Nautischen Clubs
«Heute sind alle Frauen sexy. Das ist eine executive Order.» Als Antwort brandet begeisterter Jubel auf. Der Tagesatzung von Mr. President, dem Eurodance-Star aus den 90er Jahren folgt die Menge vor der Aarebühne nur zu gerne. Der drahtige Entertainer mit der charakteristischen Bass-Stimme weiss, wie man Frauen dazu bringt, beim Tanzen alle Hemmungen fallen zu lassen.
Mit seinem Überhit «Coco Jambo», den er gleich zu Beginn zelebriert, hat er sein Publikum sofort im Sack – und hält es fortan quirlig bei der Stange. «Keep your hands in the air!» Das Publikum sing begeistert mit, auch dem zweiten Hit «I give you my heart» und bei der Reprise von «Coco Jambo». Das Publikum lässt sich unter den Bäumen vor der direkt beim Pontoniereinstieg angebrachten Aarebühne mit Genuss beschallen und macht Party. Später noch zur Musik von Captain Jack, einem weiteren Eurodance-Star.
Operation mehr als gelungen. Der Aarburger Koni Begert, OK-Chef vom Strandfest, freut sich. «Der Freitag hat bis anhin ein eher stiefmütterliches Dasein genossen. Mit unserem Eurodance-Feuerwerk und unserem reichen Foodangebot mit zahlreichen Essensständen konnten wir nun schon am ersten Tag rund 1500 Eintritte verbuchen.»
Das richtige Feuerwerk über der Aare vor der Kulisse der einzigartigen Aarburger Festung zieht am Samstag viermal so viel Publikum. Das rhythmisch auf die Begleitmusik von Acts wie Adele oder Sia abgestimmte farbenprächtige Spektakel zeichnet satte 25 Minuten lang endlose Farbmuster, Palmen, Sträusse von Blumen und Girlanden in den Nachthimmel. Man kann sich da so richtig sattsehen. Als die drei Knaller das Ende markieren, ertönt dankbarer Applaus über dem Aarebecken. Koni Begert, der an diesen beiden Tagen bis zu 150 Helferinnen und Helfer orchestriert hat, hat ein Grinsen auf dem Gesicht und ist sichtlich zufrieden. Das alle zwei Jahre stattfindende Strandfest ist seinem Ruf mehr als gerecht geworden.

Bild: Claudio Thoma/claudiothoma.com

Bild: Claudio Thoma/claudiothoma.com

Bild: Claudio Thoma/claudiothoma.com

Beerenstark: Jetzt sind auch Himbeeren und Heidelbeeren reif
Oftringen Der Egghof hat ein breites Beeren- und Obstangebot
«Wir haben grosses Glück gehabt – und gottseidank eine aufmerksame Nachbarin», sagt Sandra Eggen. Der Schreck sitzt der fünffachen Mutter und Bauersfrau verständlicherweise immer noch in den Knochen, obwohl nichts mehr auf einen Feuerwehreinsatz hindeutet. Heu hat sich auf dem Egghof unbemerkt entzündet, eine aufmerksame Nachbarin hat die Rauchentwicklung glücklicherweise beobachtet und sofort die Feuerwehr alarmiert. Der Schwelbrand war ebenso schnell gelöscht wie die Feuerwehr vor Ort.
Der Egghof am Dorfrand von Küngoldingen ist ein vielfältiger, mittelgrosser landwirtschaftlicher Familienbetrieb, den Andreas und Sandra Eggen in vierter Generation seit 2009 führen. Zuerst als Pächter, bevor sie 2020 den Hof von Fritz und Annelise Eggen übernommen haben. Seither haben die beiden – Andreas Eggen ist für die Produktion, seine Frau Sandra für den Vertrieb zuständig – den gut aufgestellten Betrieb leicht umstrukturiert. «Mein Vater hat noch Milchwirtschaft betrieben, diesen Betriebszweig haben wir zu Gunsten der Rindermast inzwischen ganz eingestellt», sagt der 49-jährige gelernte Landwirt. Haupterwerbszweig ist heute der Anbau von Beeren und Obst, der auf einer Fläche von rund 2 ½ Hektaren erfolgt und den die heutigen Betriebsinhaber beträchtlich erweitert haben. Auf dem Hof werden auch noch Hühner gehalten, etwas Acker- und Futterbau sowie wenig Gemüseanbau betrieben. «Dank unserer Vielfalt können wir im Hofladen übers ganze Jahr hindurch Frischprodukte aus der Region anbieten», betont Eggen.
Lange Beerensaison dank akribischer Planung
Erdbeeren gehören mit einem jährlichen Pro-Kopf-Konsum von fast 2 ½ Kilogramm zu den beliebtesten Früchten von Herr und Frau Schweizer. Auch auf dem Egghof ist die «Königin der Beeren» die auf der grössten Fläche angebaute Beere. Und auch die am frühesten erhältliche. Er freue sich jedes Jahr von Neuem, wenn die Beerensaison beginne, betont der Küngoldinger Landwirt und damit meine er den wunderbaren Moment, wenn die ersten Erdbeer-Stauden zu blühen beginnen. Damit starte auch die Vorfreude auf das Pflücken der ersten reifen Erdbeere. Dann verstummt Eggen kurz, lächelt und verrät, dass die Familie beim Verzehr der ersten Erdbeere eine ganz wunderbare Tradition pflegt. «Sie wird am Küchentisch geschnitten und unter allen Familienmitgliedern geteilt».
Bereits anfangs Mai werden dann die ersten Erdbeeren gelesen. Und sie sind ab diesem Zeitpunkt, sofern das Wetter mitspielt, durchgehend bis mindestens Ende September erhältlich. Dank akribischer, fast generalstabsmässiger Planung. «Wir haben unsere gesamte Beerenproduktion so aufgebaut, dass wir unsere Abnehmer möglichst ohne Unterbruch und möglichst lange beliefern können», führt Andreas Eggen aus. «Das erreichen wir einerseits dadurch, dass wir bei sämtlichen Beeren sowohl Früh- als auch Spätsorten anbauen, andererseits verfügen wir auch über gedeckte Produktionsflächen».
Die Vielfalt an Beeren und Obst vom Egghof wächst im Juni stark an. Momentan werden neben Erdbeeren auch Himbeeren sowie Kirschen gelesen, in den nächsten Tagen beginnt auch die Heidelbeerernte. Und schon bald werden auch Brombeeren und Johannisbeeren aus Küngoldingen im Angebot sein. Verkauft werden die Produkte im Hofladen sowie an zwei Verkaufsständen, beliefert werden diverse Detailhandels-Unternehmen, Alterszentren, Bäckereien und Restaurants in der Region.
Wetter wird zunehmend zur Herausforderung
Die Wetterbedingungen liessen die Herzen der Schweizer Beerenproduzentinnen und -produzenten im Mai höherschlagen. Viel Sonne und milde Temperaturen sorgten bei den Erdbeeren für eine ausgezeichnete Qualität. Der Schweizer Obstverband rechnete mit einer Inlandernte von 7500 Tonnen – das wäre die zweithöchste Erntemenge innerhalb der letzten zehn Jahre. «Leider sorgten dann Hagelschläge und starke Platzregen in den ersten Junitagen bei uns für beträchtliche Schäden», bedauert Andreas Eggen. «Wir haben trotz Hagelnetzen bei den Erdbeeren Ausfälle in der Grössenordnung von 30 Prozent erlitten».
Die extremen Wetterbedingungen der ersten Junitage hätten einmal mehr exemplarisch gezeigt, dass das Wetter für die Beerenproduzenten zunehmend zur Herausforderung würde. «Ich denke, dass die Zukunft allein im gedeckten Anbau liegt», betont Andreas Eggen. Die Abdeckungen seien zwar ein riesiger Kostenfaktor, doch er sei überzeugt, dass sich die Investitionen positiv auf die Erträge auswirken und sich auch langfristig rechnen würden. Ein zusätzlicher Vorteil des gedeckten Anbaus liegt darin, dass im Tunnel vermehrt mit Nützlingen gearbeitet werden kann. Ein Beispiel seien Thripse, die Himbeeren schädigen, indem sie Pflanzensäfte aussaugen und so zu Blattaufhellungen und Verfärbungen führen. Bei starkem Befall können auch die Früchte Schaden nehmen. Gegen Thripse setzt Eggen Raubmilben als Nützlinge ein. «Unter dem Strich kann ich mit dem Einsatz von Nützlingen rund 70 Prozent der Pflanzenschutzmittel weglassen», gibt der Küngoldinger Landwirt zu verstehen.
Eine weitere Herausforderung sei die Kirschessigfliege, welche vor allem überreife Beeren befalle. Da brauche es eine Top-Hygiene beim Pflücken. Überreife Früchte müssten konsequent entsorgt, der Erntezeitpunkt richtig bestimmt werden. Was auf einem Selbstpflückfeld bestimmt etwas schwieriger ist. «Ja», gibt Eggen unumwunden zu, «aber dort ‹putzen› unsere Mitarbeitenden regelmässig nach». Gerade bei den Himbeeren sei der Aufwand zwar gross, aber es sei doch wunderbar zu sehen, wie die Leute freudestrahlend mit einer Schale selbst gepflückter Himbeeren aus dem Feld kommen würden, meint der Beerenproduzent aus Küngoldingen. Wie wahr: Beim anschliessenden Fotoshooting möchte der Fotograf noch ein Bild von den Himbeeren schiessen. «Gehen Sie nur rein und probieren Sie unbedingt», fordern mich Sandra und Andreas Eggen auf. Welch unglaubliche Menge an reifen Himbeeren! Klick hier, klick da, dazwischen eine Himbeere in den Mund und wieder raus aus der Plantage. Andreas Eggen lächelt: «Jetzt hätten Sie Ihr strahlendes Gesicht sehen sollen».

Bild: Thomas Fürst

Bild: Thomas Fürst

Mit viel Kreativität das Motto umgesetzt und das Kindsein gefeiert
Oftringen Das Kinderfest wurde unter dem Motto «farbenfroh» gefeiert – Tausende Besucher kamen zum Umzug
Das diesjährige Motto «farbenfroh» lässt Spielraum für viele kreative Kostüme. So laufen an diesem Samstag bunte Gärtnerinnen, talentierte Künstler, hübsche Blumen und mehrere Schwärme an Regenbogenfischen die Umzugsstrecke ab. Die Chindsgi- und Primarschulkinder haben sich schon Wochen im Voraus auf dieses Kinderfest vorbereitet. Sie haben gemalt, gezeichnet, geklebt, getackert und ausgeschnitten. Und es hat sich gelohnt: Der Umzug ist eine kunterbunte Augenweide.
Das Kinderfest ist wie jedes Mal ein Riesenplausch, aber trotzdem ist einiges anders als in den Vorjahren. Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe laufen nicht mehr beim Umzug mit, singen aber am Vorabend drei grosse Chorkonzerte, die sich hören lassen können. Mit der geballten Stimmkraft von jeweils einer Klassenstufe ernten sie zu Recht tosenden Applaus. Ebenfalls neu ist, dass nun ein grosses Festzelt auf der Wiese des Festgeländes steht. Das Kinderfest ist nun gegen grellen Sonnenschein und strömenden Regen geschützt.
«Wir feiern ein fröhliches Zusammensein», erklärt Moderator Christoph Studer bei der Eröffnung am Freitagabend und fasst damit die Essenz des diesjährigen Kinderfests in einem Satz zusammen. Während sich am Vorabend Lehrpersonen und Schüler in einem Volleyballmatch messen, geniessen die Kinder am Samstag nach dem farbenfrohen Umzug ihr Fest an Spielposten, auf der Hüpfburg oder im Lunapark. Egal wo: An diesem Tag wird das Kindsein gefeiert!

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Bild: Regina Lüthi

Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi 
Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi 
Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi 
Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi 
Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi 
Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi 
Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi 
Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi 
Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi 
Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi 
Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi 
Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi 
Impressionen des Kinderfestumzugs Oftringen am 21. Juni 2025. – Bild: Regina Lüthi

Der neue Glanz in den alten Gemäuern kommt sehr gut an
Aarburg Tag der offenen Tür im Rathaus / Winkelgebäude
In Scharen strömten Aarburgerinnen und Aarburger am vergangenen Samstag ins Städtchen, um die umgebauten Verwaltungsgebäude Rathaus und Winkel zu besichtigen. Dabei durften Stadtrat und und die anwesenden Mitarbeitenden der Verwaltung sehr viele positive Rückmeldungen entgegennehmen. «Es ist wunderbar geworden, gratuliere», meinte etwa Christoph Ruesch kurz nach Türöffnung in Richtung Stadtpräsident Hans-Ulrich Schär. Peter Gretz wiederum freute sich darüber, dass «die historische Bausubstanz fachgerecht erhalten wurde». Auf der anderen Seite schätzen auch die Mitarbeitenden die modernen Arbeitsplätze in den wunderbar sanierten Räumen der beiden Gebäude, die jetzt miteinander verbunden sind. «Die Räume sind sehr angenehm zum Arbeiten», meinte etwa Jürg Matter, Leiter Finanzen.

Bild: Thomas Fürst
Nach dem Rundgang durch die Räumlichkeiten offerierte der Stadtrat allen Anwesenden im lauschigen Museumsgärtli einen kleinen Imbiss samt Getränk. Aufgrund der abgegebenen Würste konnte die Besucherzahl auf rund 300 geschätzt werden. «Der Tag der offenen Tür ist aus Sicht der Stadt angesichts der grossen Besucherzahl ein grosser Erfolg», betonte Hans-Ulrich Schär. Der Stadtpräsident vergass auch nicht, dem OK-Team von der Verwaltung – Jesper Ott, Patrizia Schmutz und Claudia Castañal Bouso – einen grossen Dank auszusprechen.

Bild: Patrizia Schmutz

Rund 6.400 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet
Vordemwald 30-Jahre Jubiläum Sennhofverein
Der Sennhofverein wurde 1995 gegründet mit der Absicht, als Botschafter für das Pflegeheim Sennhof zu wirken, ideell zu unterstützen und in den Gemeinden im Bezirk Zofingen zu verankern. Heute zählt der Verein rund 600 Mitglieder, von denen über 70 freiwillig tätig sind. In den letzten Jahren hat sich der Bestand der freiwillig tätigen Mitglieder erfreulicherweise kontinuierlich erhöht.
Das Leitmotiv des Vereins lautet «Zuwendung schenken». Dieses Leitmotiv wird von den Mitgliedern, die sich freiwillig engagieren, in ihren täglichen Einsätzen umgesetzt. Diese Einsätze sind sehr vielfältig und umfassen Einzelbetreuung, Mithilfe bei der Aktivierung (singen, tanzen, werken, etc.), Unterstützung im Gottesdienst, Fahrer für den Mahlzeitendienst, Chauffeur und Begleitung für Arztbesuche, Begleitung und Betreuung bei auswärtigen Mittagessen und vieles mehr. Im Jahr 2024 wurden im Rahmen dieser Tätigkeiten rund 6.400 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet.
Freiwilligenarbeit ist die Säule
Der Vorstand durfte in der Hütte beim Werkhof in Pfaffnau 39 Mitglieder begrüssen, darunter auch zwei Gründungsmitglieder sowie zwei ehemalige Vereinsvorsitzende. Bei einem Willkommens-Apéro in entspannter Atmosphäre wurden viele angeregte Gespräche geführt. Präsidentin Jacqueline Bär betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung der freiwillig Tätigen. Diese seien das Fundament und die Säulen des Vereins.
Bernadette Leibacher, die erste Präsidentin des Vereins, wandte sich ebenfalls an die Anwesenden und freute sich enorm über die Entwicklung, die der Verein in den vergangenen 30 Jahren gemacht hat. Den Gründungsmitgliedern und den ehemaligen Vereinsvorsitzenden wurde unter grossem Beifall ein Geschenk überreicht.
Anschliessend an den «offiziellen Teil» folgte das Mittagessen. Es durfte sich jeder bei «Kurtis Güggeli Grill» selbst bedienen. Neben den knusprigen Güggeli wurden auch Ofenkartoffeln mit Gemüse sowie ein grosses Salatbuffet angeboten.
Nach dem Mittagessen würdigte Heimleiter Urs Schenker in seiner Rede den Wert der Freiwilligenarbeit zugunsten der Bewohner des Pflegeheims Sennhof. Dieser Einsatz wird nicht nur vom Sennhof geschätzt, er wird auch ausserhalb des Sennhofs wahrgenommen. Als Dank wurde dem Sennhofverein eine Tafel mit den Namen und jeweils passenden Adjektiven aller freiwillig Tätigen überreicht, welche nächste Woche im Pflegeheim installiert wird.
Als persönliches Geschenk der Heimleitung wurde jedem Mitglied das Buch «Bleib, wie du wirst» von André David Winter zum Thema Demenz überreicht. Zum Abschluss wurde, wie es sich für einen runden Geburtstag gehört, eine Geburtstagstorte serviert. Die Jubiläumsfeier hat einmal mehr gezeigt, wie gross die Motivation der freiwillig Tätigen ist, ihre Zeit den Heimbewohner zu widmen. Als Zeichen der Wertschätzung dafür durfte jedes Mitglied ein Geschenk mit auf den Heimweg nehmen.

Als der Pöstler mit der «zweirädrigen Postkutsche» vorfuhr
Zofingen Die 76. Folge der beliebten Mühlethaler Geschichten
Nach der Geschichte Nummer 37 vom Brand des letzten Mühlethaler Strohdachhauses im «Seiler», die Ende 2020 im «Wiggertaler» erschienen ist, folgt hier René Murris Kapitel über die Post: «Die Post ist da…!» Dies war für uns Kinder ein Zauberwort – ein Moment voller Spannung und froher Erwartung. Selbst für die erwachsenen Dorfbewohner war die elfte Morgenstunde ein ersehnter Augenblick. Wenn sie es auch nicht immer wahr haben wollten. Entschlüpfte doch der einen oder anderen Mutter beim Elfuhrläuten der Befehl: «Geh, Hans oder Lieschen, hol rasch die Post, wir wollen schauen, was es Neues gibt!» Denn mit dem Einläuten des Nachmittages, das in Mühlethal um elf Uhr geschicht (warum, weiss glaube ich niemand mehr), vernahm man auch ein Hupen und das Geknatter eines alten Motorrades unten an der «Neuenstrasse». Bald darauf zog der Postillion seine elegante Auslaufschlaufe auf dem Dorfplatz, um immer an der gleichen Stelle seine zweiräderige «Postkutsche» anzuhalten. Ich glaube, man hätte einen Zweimeterkreis ausstecken und markieren können, und es wäre in den vielen Jahren seiner Dienstzeit nie vorgekommen, dass er ausserhalb der Markierung parkiert hätte. Nur ganz ausserordentliche Fälle konnten ihn dazu bewegen, seinen gewohnten Freiluftpostplatz zu wechseln. Kaum hatte er jeweils sein Motorrad abgestellt und den Strick über dem umfangreichen Weidenkorb gelöst, der an Stelle des hinteren Sitzes aufmontiert war, so standen auch schon die «Delegationen» der Dorffamilien abwartend rings um ihn. Und niemand fehlte, ob es stürmte, regnete oder ob die Sonne lachte. Buben und Mädchen oder auch die Hausfrau selbst, wenn gerade kein Kind aufzutreiben war, betrachteten dann mit kritischen Augen das beinahe rituelle Öffnen der nach Wohngebieten gebündelten und verschnürten Postpakete. Was konnte heute die Post alles bringen? Gab es Ärger mit Rechnungen, gab es Briefe von Verwandten oder sogar ein kleines Päcklein? Er allein wusste es – er unser «Pösteler».
Keine alte Burg, aber schöne Geschehnisse
Die Spannung stieg bis zum Kribbeln, wenn er mit freundlicher Stimme und mit seinem bekannten Schmunzeln die Namen aufrief, und sie verebbte so wohltuend langsam, wenn er uns dann mit guten, manchmal vielleicht auch mit schlechten Nachrichten versehen entliess. Wir liebten es, das ganze Drum und Dran, freilich, es war alltäglich, aber es war für uns Dörfler die einzige Abwechslung, und stellte jeden Tag ein neues Erlebnis dar. Es war ein kleines Stück Tradition («Nanu – Tradition!» mögen Sie jetzt sagen, «das ist aber fadenscheinig.» Oh, gar nicht, im Gegenteil!) Nicht jedes Dorf hat eine alte Burg oder irgendeine altüberlieferte Begebenheit. Wir in Mühlethal hatten nur kleine, aber schöne Geschehnisse, die wir aber umso mehr liebten und umso sorgfältiger zu wahren suchten. Und sie verleihen dem Dorf, teilweise noch heute, eine besondere Eigenart, einen ganz bestimmten Charakterzug.»
In Murris Jugend war übrigens Fritz Bolliger Posthalter. Ein Bild von ihm auf dem Pferdeschlitten ist in der letzten Mühlethaler Geschichte erschienen. Auch Bolligers Nachfolger Werner Roth, der 1956 die Mühlethaler Post übernahm, war zu Beginn noch mit dem Motorrad unterwegs.

Mit Hammer, Pinsel und jeder Menge guter Laune
Zofingen Sommerferienspass im Spittelhof
«Heute ‹räblet´s› aber gerade richtig», meint Seraina Combertaldi lachend. Das Kursangebot für den Sommerferienspass im Spittelhof ist an diesem Nachmittag online gegangen – und jetzt kommen die Anmeldungen im Minutentakt herein. Auch wenn gerade einiges an Büroarbeit ansteht, Zeit für ein Gespräch nimmt sich die Spittelhof-Leiterin zusammen mit Andrea Christen gerne.
«Der Sommerferienspass ist immer ein absolutes Highlight im Spittelhof-Jahr – für die Kinder und das Team», betont Seraina Combertaldi. «Dank unseren zehn Helfenden können wir so ein grosses Programm durchführen, sie machen es erst möglich», ergänzt Andrea Christen. Der Sommerferienspass in der Zofinger Freizeitwerkstätte ist eine langjährige Tradition, die bis in die 1980-er-Jahre zurückgeht. Damals allerdings wurde er in ganz kleinem Rahmen durchgeführt. So wurden 1989 gerade einmal acht Ferienkurse angeboten, in den folgenden Jahren wurde das Kursangebot aber stetig ausgebaut. «In den letzten Jahren konnten wir immer zwischen 75 und 80 Kurse durchführen», schätzt Seraina Combertaldi.
Handwerk, Erlebnis und Sport
Das Angebot bewegt sich auch dieses Jahr im Rahmen der Vorjahre und ist äusserst umfangreich. 87 Kurse sind insgesamt ausgeschrieben. «Ziemlich genau ein Drittel machen handwerkliche Kurse aus, ein weiteres Drittel sind Erlebniskurse, das letzte Drittel gehört zum Bereich Abenteuer/Sport», weiss die Spittelhof-Leiterin. Insgesamt bietet der Verein etwa 900 Kursplätze an. Ein gewaltiger Aufwand für das Leitungsteam, das etliche der Kurse auch selbst leitet. Ein Aufwand, der sich aber in jedem Fall lohnt, wie Andrea Christen betont. «Die leuchtenden Augen der Kinder sind der grösste Lohn für die Leitenden», sagt sie.
Tierkurse sind der grosse Renner
Absoluter Renner im Programm sind seit vielen Jahren die Tierkurse. «Ponys, Lamas, Besuche beim Tierarzt – da könnten wir noch viel mehr Kurse anbieten», führt Seraina Combertaldi aus. Das ist auch dieses Jahr so. Innerhalb von 24 Stunden waren die doppelt ausgeschriebenen Kurse wie «Ponypower», «Besuch beim Tierarzt» und «Landschildkröten-ABC» restlos, weitere Kurse wie «Morgenspass mit Lamas», «Einhorn-Pony» und «Reiten auf Islandpferden» beinahe ausgebucht.
Auch in ganz anderen Bereichen werden Erlebniskurse angeboten: Bei einem Besuch bei der Modellfluggruppe Zofingen können Jugendliche Einblicke in den Modellflug gewinnen. Auch die Regionalpolizei Zofingen öffnet ihre Türen für einen Morgen und zeigt den Alltag eines Polizisten. Wer wohnt im Wald und hinterlässt welche Spuren? Und wie wird aus einem kleinen Samen ein grosser Baum? Das sind Fragen, welche auf einer Entdeckungsreise durch den Wald beantwortet werden.

Bild: Archiv Wiggertaler / Regina Lüthi
Trendsportarten auf dem Vormarsch
Wer es sportlicher mag, kommt beim Sommerferienspass auf jeden Fall auf seine Rechnung. Denn das Angebot ist ebenso vielfältig und gross wie bei den Erlebniskursen. Und trendig. Die momentan schnell wachsende Begeisterung für Padel, ein vom Tennis abgeleitetes Rückschlagspiel, das mit Kunststoffschlägern ohne Bespannung gespielt wird, hat auch beim Sommerferienkurs voll durchgeschlagen. Der Kurs war schnell ausgebucht, ein zusätzlicher Kurs ist in der Zwischenzeit aufgeschaltet worden.
Ebenso gross ist die Faszination für Parkour, ein sportlicher Hindernislauf, bei dem es darum geht, durch die Kombination von Laufen, Springen, Klettern und Balancieren möglichst effizient und kreativ Hindernisse zu überwinden. Angeleitet werden die Teilnehmenden durch einen echten Ninja Warrior Athlet. Leider sind die beiden Kurse bereits ausgebucht. Freie Plätze gibt es dafür noch im Sägemehl oder auf der Judomatte – für alle, die sich einmal im Schwingen oder im Judo versuchen möchten.
Handwerkliche Kurse haben tendenziell abgenommen
Als der Spittelhof im Juli 1964 als Freizeitanlage «im Güetli» gegründet wurde, hatten die Gründer vor allem die Jugend in den Wohnblocksiedlungen im Visier, der sie eine Möglichkeit für eine handwerkliche Tätigkeit und sinnvolle Freizeitgestaltung bieten wollten. Mit einer Holz- sowie einer Töpferwerkstatt im Haus misst der Spittelhof den handwerklichen Angeboten noch heute grosse Bedeutung zu. «Wir müssen allerdings feststellen, dass die Nachfrage nach handwerklichen Kursen in den letzten zehn Jahren im Spittelhof nachgelassen hat», betonen die beiden Mitglieder des Spittelhof-Teams. Auf einen kurzen Nenner gebracht. Die Handy-Generation lässt grüssen. Gleichzeitig lasse sich feststellen, dass auch die handwerklichen Fähigkeiten, welche die Kinder mitbringen würden, merklich nachgelassen hätten. Ob das gute Aussichten für den Werkplatz Schweiz sind – Stichwort Fachkräftemangel – bleibe dahingestellt. Und trotzdem hält Seraina Combertaldi fest: «Wenn die Kinder in den Werkkursen einmal da sind, sind sie mit Freude dabei».
Schliesslich gibt es ja auch ganz coole Werkstücke, die sich in den Ferienkursen im Spittelhof herstellen lassen: Ein Rennboot mit Gummiantrieb, lustige Schafe und Ziegen aus Wolle und Draht, verschiedenste Schmuckgegenstände und Accessoires, Armbändeli aus Filz, tolle Glücksbringer aus Speckstein, ein zappeliges Gartenmonster, ein tolles Windspiel in Form eines Vogels oder sogar selbst gemachte Fackeln.
So geht es in knapp einem Monat so richtig los mit einer der ereignisreichsten Wochen im Spittelhof, wenn am 7. Juli die erste Woche des Sommerferienspasses startet. Mit hoch motivierten Leiterinnen und Leiter und ganz vielen leuchtenden Kinderaugen. Und ganz gut zu wissen: Auch weniger bemittelte Kinder können mitmachen: Wer in Besitz einer gültigen KulturLegi-Karte ist, erhält gegen Vorweisen 50 Prozent Rabatt auf das gesamte Kursangebot.

Bild: Archiv Wiggertaler / Regina Lüthi

Mit dem Umzug am Samstag erreichten die Festlichkeiten ihren Höhepunkt
Strengelbach Endlich konnte wieder ein Kinderfest stattfinden
Mit dem Glockenschlag der reformierten Kirche setzte sich der Festzug in Bewegung. Lange hatten die Schülerinnen und Schüler gebastelt, geübt, sich herausgeputzt für das diesjährige Kinderfest, und nun war es endlich so weit. Voraus marschierte die Musikgesellschaft und führte die Klassen durch die dicht gesäumten Strassen. Das ganze Dorf hatte sich versammelt, um dem Umzug beizuwohnen.
Endlich wieder ein richtiges Kinderfest
Vor vier Jahren hatte die Pandemie dem traditionsreichen Fest einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso schöner war es, am Samstag den Umzug in altbekannter Pracht durchführen zu können. Jede Klasse hatte im Vorfeld ihr eigenes Thema vorbereitet, fleissig an Dekorationen und Girlanden gebastelt, und so erfüllte eine kindliche Leichtigkeit die Strassen Strengelbachs, als die Schülerinnen und Schüler stolz an ihren Familien vorbeizogen.
Die Tambouren Lenzburg in ihren königsblauen Uniformen gaben den Takt vor, bis sich der Umzug auf dem Festgelände beim Schulareal einfand. Ein Glacewagen und erfrischende Getränke verschafften Abkühlung von der brennenden Mittagssonne. Dann richtete Gemeindeammann Stephan Wullschleger einige Worte an die Dorfgemeinschaft. Mit einem Massstab und bunten Wäscheklammern schuf er eine Allegorie auf die Dauer eines Menschenlebens. Das Kinderfest sei nur eine Station von vielen, spannende Gelegenheiten würden in Zukunft noch auf sie warten. «Freut euch auf alle Abenteuer, die noch kommen werden, und nutzt eure Zeit, seid glücklich, und geniesst das Leben in vollen Zügen.»
Doch die Kinder schienen es ohnehin richtig zu machen. Sie genossen den Moment, erfreuten sich an der ausgelassenen, festlichen Stimmung und schufen so ihr eigenes, zauberhaftes Kinderfest.

Bild: Oliver Healy

Bild: Oliver Healy

Bild: Oliver Healy

Bild: Oliver Healy

Bild: Oliver Healy

Bild: Oliver Healy

Ein wunderbares Fest für alle Generationen
Zofingen Seniorenzentrum: Neuer Name – bewährte Werte
Geschäftsleiter Marcel Rancetti verriet im Gespräch, dass er den Namen bereits seit drei Jahren im Hinterkopf hatte. «Casa» steht für das Zuhause, «Alegre» symbolisiert Freude, Vitalität und Leichtigkeit. Rancetti führte im Gespräch – und später in seiner Begrüssung der Gäste aus, dass der Name zum Ausdruck bringt, für was das Seniorenzentrum steht. «Es ist ein Ort der Geborgenheit und Sicherheit für alle Pflegebedürftigen, das ist nicht immer vom Alter abhängig.»
Stadtpräsidentin Christiane Guyer rollte in ihrer Festansprache die Geschichte des Seniorenzentrums auf und verglich diese mit dem Mammutbaum, der direkt vor dem Brunnenhof steht.
Alle Generationen waren zum Fest mit dem Motto «Lebensqualität am Heitern» eingeladen. Das Programm reichte von Führungen durch die Häuser, einem Vortrag zur Altersmedizin, über Musik, Tanz, Glücksrad und leckeres Essen bis Kutschenfahrten und Säulirennen. Letzteres erfreute sich grosser Beliebtheit – beim Wettbüro bildete sich eine lange Schlange. Dementsprechend gross war die Freude bei denjenigen, die auf das «blaue Schweinchen» gesetzt hatten. Eine Beachbar inclusive Pool für die Kleinen rundeten die Festlichkeiten genauso ab wie Büchsenwerfen und andere spielerische Aktivitäten.
Eine schöne Geste: der Erlös vom Verkauf von Glace, Kuchen und Desserts ging vollumfänglich an das Dorf Blatten im Wallis.

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi

Bild: Patrick Lüthi

Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi 
Impressionen zur Jubiläumsfeier mit Bekanntgabe der Namensänderung im Casalegre. – Bild: Patrick Lüthi

Ein musikalisches Feuerwerk für Herz, Bauch und Beine
Zofingen Am 30. Juni findet das 27. «New Orleans meets in Zofingen» statt
«Wir haben letztes Jahr genau richtig entschieden», sagt Walter Bloch, der zum elften Mal das Organisationskomitee von «New Orleans meets in Zofingen» (NOMZ) präsidiert. «Mit der gleichen Leidenschaft wie eh und mit einem tollen OK an meiner Seite», wie der 71-jährige Mühlethaler präzisiert. Das Problem, welches die NOMZ-Macher vom Kiwanis-Club plagte: Beim letzten Jazz-Act auf dem Thutplatz haben sich die Reihen der Zuschauer nach 22 Uhr jeweils gelichtet. Mit dem Auftritt von George, dem bekannten Mundart-Rocker aus dem Berner Seeland, wurde versucht, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Der Versuch schlug voll ein. George hätte vor gut besetzten Rängen weit über Mitternacht hinaus spielen können.
«Der Entscheid, das neue Konzept beizubehalten, war im OK natürlich schnell gefällt», betont Bloch. Bei der Suche nach einem Top-Act aus der Schweizer Musikszene hat das OK offensichtlich ein goldenes Händchen gehabt. Mit Florian «Flöru» Ast wurde jener Musiker nach Zofingen geholt, der vor kurzem mit dem Prix Walo in der Kategorie «Pop/Rock» ausgezeichnet wurde. Ast, der in seiner 30-järhigen Karriere über eine Million Tonträger verkaufte hatte, hatte sich im vergangenen Jahr nach siebenjähriger musikalischer Retraite mit dem Album «Ast a la vista» – Ast in Sicht – zurückgemeldet. Ob Ast neben seinen neuen Songs auch seine grössten Hits mit im Gepäck haben wird: «Träne», «Ängu», «Daneli»? Begleitet wird Ast von einem erfahrenen NOMZ-Musiker. Den musikalischen Tausendsassa und Bandleader Christoph Walter mit seinem Orchester muss man niemanden mehr vorstellen. Ebenfalls mit auf der Bühne ist Nelly Patty, die temperamentvolle französische Chansonnière mit italienischen Wurzeln, die mit ihrer wunderbaren Stimme jedes Publikum in ihren Bann zu ziehen vermag.

Bild: zvg / Daniel Gassner
Davor kommen auf dem Thutplatz aber auch die Fans von klassischem Jazz voll auf ihre Kosten. Den Auftakt macht um 17.30 Uhr die Riverstreet Jazzband aus Aarau. Das klassische Old Time Jazz-Sextett, bestehend aus Trompete, Klarinette, Posaune, Banjo, Bass und Schlagzeug, wurde 1960 gegründet und etablierte sich rasch an der Spitze der Aargauer Jazzszene. Stilistisch bewegt sich die Band zwischen Dixieland, New-Orleans-Jazz der 20er- und Swing der 30er-Jahre, bis hin zu Einflüssen aus der Pop- und Rock-Szene.
Ganz in der Tradition des New Orleans-Jazz steht die tschechische Formation J.J. Jazzmen, die auf dem Thutplatz ab 19.30 Uhr aufspielt. Der Sound der Band wird durch die ausdrucksstarke Stimme und das Jazzfeeling der Sängerin Barbora Vágnerová bereichert, die sich in den fünf Jahren der Zusammenarbeit mit J.J.Jazzmen eine hervorragende Position unter den zeitgenössischen Jazzsängerinnen erarbeitet hat.
Alter Postplatz ganz im Zeichen des Blues
«Just the blues». Fleetwood Mac, Danny Kaye, Louis Armstrong, John Martin und viele andere haben den bekannten Song interpretiert. «It´s just the blues» – das ist ganz eindeutig auch das Motto derjenigen Bands, die am NOMZ auf der Bühne am Alten Postplatz auftreten. Larissa Baumann gilt als erfrischender Wind in der schweizerischen Blues- und Soul-Szene. Mit energiegeladener Bühnenpräsenz und ihrer souligwarmen Stimme wird sie – begleitet von ihrer fünfköpfigen Band – das Publikum auf dem Alten Postplatz ab 18 Uhr begeistern.
Weiter geht´s dann ab 20 Uhr mit der Johnny Max Band, einer kanadische Blues- und Roots-Band aus Ontario, die seit über 25 Jahren aktiv ist. Angeführt wird sie vom charismatischen Sänger und Entertainer Johnny Max, der für seine energiegeladenen Live-Auftritte und seinen humorvollen Stil bekannt ist. Die Band kombiniert klassischen Blues mit Elementen aus Soul, Funk und Rock und bezeichnet ihren Sound selbst als «Roadhouse Soul».
Blues, Gospel und Soul mit Stil und Wucht: Das versprechen Samantha Antoinette & The Chargers bei ihrem Auftritt ab 22 Uhr auf dem Alten Postplatz. Ein Auftritt, der unter die Haut geht und kaum jemanden stillstehen lassen wird. Die britische Sängerin verfügt über eine kraftvolle, tief bluesige und zugleich samtige Stimme und wird von einer vierköpfigen Band aus hervorragenden Musikern begleitet. Darunter befinden sich mit Kasper «Lefty» Vegeberg und Sören Schack zwei der talentiertesten Gitarristen aus Dänemark. Ergänzt wird das Ensemble durch den Bassisten Jakob Kirkegaard Kortbaek und den Schlagzeuger Asmus Jensen.

Bild: zvg / Frank Nielsen
Rock´n´Roll auf dem Chorplatz
Ein Parforceprogramm spulen «Terry & the Hot Sox» am NOMZ ab. Von 19 – 23.30 Uhr treten sie zu jeder vollen Stunde mit fetzigem Rock´n´Roll auf dem Chorplatz ab. Die Schweizer Band wurde 1980 gegründet und zählt zu den langlebigsten Gruppen des Genres im Land. Ursprünglich aus der Jazzrock-Band Shivananda hervorgegangen, fand die Formation mit Sänger Walter «Terry» Senn ihren unverkennbaren Sound.
Last but not least wird mit «The Bienville Street Band» als Marching Band auf dem Festgelände unterwegs sein. Die Band aus Biel ist eine mittelgrosse Jazzband, die eine spritzige Mischung aus Spirituals, Blues, Songs, Ragtime, Marschmusik sowie Oldtime Jazz zelebriert.
Viel Aufwand für einen guten Zweck
Acht Bands, die grösstenteils aus der Schweiz und dem europäischen Ausland kommen. Beim diesjährigen Programm habe es für jeden Geschmack etwas dabei, ist sich Walter Bloch denn auch sicher. «Es ist dem OK wiederum ausgezeichnet gelungen, ein musikalisches Feuerwerk für Herz, Bauch und Beine zu organisieren», meint der OK-Präsident. Mit wunderbarer Musik fürs Herz und einer leistungsfähigen Gastronomie für den Bauch. «Und natürlich ist es auch nicht verboten, ab und zu ein Tänzchen auf die Pflastersteine der Altstadt hinzulegen», meint er schmunzelnd. Das Ganze zu einem sehr sozialen Preis. Wo kann man schon einen ganzen Abend sämtliche Konzerte für bescheidene 25 Franken Eintritt verfolgen? Wobei Jugendliche unter 16 Jahren sogar Gratiseintritt geniessen. «Das entspricht ganz dem Kiwaner-Gedanken», meint Bloch. «Serving the children of the world» – den Kindern der Welt zu dienen. Denn der Reinerlös aus dem NOMZ wird jedes Jahr einem Jugendprojekt gespendet. «In den vergangenen 26 Jahren konnte der Kiwanis-Club sozialen Institution über eine Million Franken zukommen lassen», betont Bloch. Möglich sei das nicht zuletzt dank Sponsoren, die dem NOMZ über die Jahre hinweg die Treue gehalten haben – und einem OK, das alljährlich einen gewaltigen Effort leiste, um das Festival auf die Beine zu stellen.

Bild: zvg

Am Schluss auf die Festung: Aargauer 3-Tage-OL mit spannenden Routen
Aarburg Erster urbaner 3-Tage-OL wurde im Aarestädtchen durchgeführt
Über Pfingsten wurde Aarburg zum Zentrum des Schweizer Orientierungslaufs. Der erste urbane 3-Tage-OL konnte dank hervorragender Organisation und grossem Engagement erfolgreich durchgeführt werden und zog über drei Tage hinweg täglich mehr als 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an.
Das Organisationskomitee unter der Laufleitung von Christoph Ruesch durfte auf die tatkräftige Unterstützung von jeweils 80 Helferinnen und Helfern aus den OL-Klubs Wiggertal und Olten zählen. Ihre Arbeit trug massgeblich zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung bei.
Ein besonderes Highlight war die letzte Etappe am Pfingstmontag: Die historische Festung Aarburg wurde Teil des Laufgebiets. Beim Jagdstart traten die Teilnehmer mit dem individuellen Zeitrückstand aus den vorherigen Etappen gegeneinander an – Spannung war garantiert.
Starke Wiggertaler Läuferinnen und Läufer
Die Läuferinnen und Läufer vom OL-Klub Wiggertal überzeugten mit starken Platzierungen. Maxim Bertschi holte in der Kategorie H16 den Sieg. Annalena Zinniker lief in der Kategorie D18 auf den hervorragenden 2. Platz. Henry Wymann sicherte sich in der Kategorie H14 den 5. Rang. Ronja Frey in der Kategorie D16 und Julia Emmenegger in der Kategorie DAM rundeten das gute Gesamtergebnis mit dem 6. Rang ab.
Auch das Rahmenprogramm kam nicht zu kurz: Viele Sportlerinnen und Sportler nutzten die Möglichkeit, vor Ort zu campieren. Der beliebte Family-O-Day am Samstag sorgte zudem für viel Begeisterung bei Familien mit Kindern.
Ein grosses Dankeschön geht auch an die Gemeindebehörden von Aarburg und Oftringen sowie an zahlreiche Liegenschaftsbesitzer, die ihre Areale zur Verfügung stellten und damit den Event erst ermöglichten. Die Kombination aus sportlicher Herausforderung und urbanem Erlebnis fand bei den Läuferinnen und Läufern grossen Anklang.

Bild: Kevin Steffen

Postensuche vor der Festungskulisse: Linus Baumann. – Bild: zvg 
Mit Kinderwagen auf der Strecke? – Kein Problem. – Bild: Kevin Steffen 
Kartenlesen in den historischen Gemäuern der Festung. – Bild: zvg 
Maxim Bertschi holte sich in der Kategorie H16 den Sieg. – Bild: zvg 
Dynamisch: Ramon Frey. – Bild: Kevin Steffen

Von Postläufer Johannes Hürzeler bis zum Hausservice
Zofingen Die 75. Folge der beliebten Mühlethaler Geschichten
Die Akte der Post Mühlethal im PTT-Archiv in Köniz ist nicht sehr gross. Sie besteht vor allem aus Zeitungsartikeln und Mitteilungen an die Kundschaft. Von 1849 ist vermerkt, dass «Postläufer Joh. Hürzeler» viermal wöchentlich von Zofingen her die Haushalte in Mühlethal bedient habe. Am 1. Januar 1911 erhält Mühlethal die erste rechnungspflichtige Poststelle, die von Emil Hochuli (*1875, Heimatort Reitnau) als «Ablagehalter und Briefträger» betreut wird. 1924 wurde Hochuli zum Posthalter gewählt, 1928 übergab er das Postbüro beim Lindenpass oben an Fritz Bolliger (*1890, Heimatort Uerkheim). Von ihm ist ein Foto mit Pferdeschlitten erhalten.
Bolligers Dienstlokal ist nur sieben Quadratmeter gross. Es brennen insgesamt drei Lampen darin, für die ihm die Post jährlich 15 Franken als Entschädigung zahlt, wie in den Akten vermerkt ist. Zusätzlich zu den 110 Franken Miete, 25 Franken für Heizung und 15 Franken für Reinigung. Als Bolliger 1956 in Pension geht, wechselt auch der Standort des Postbüros.
Auf einer A5-Seite teilte die Kreispostdirektion Aarau am 29. Juni 1956 mit, dass ab dem 2. Juli «Herr Werner Roth» sein Amt als Posthalter antreten werde. Zudem werde das Lokal ins Dörfli verlegt, in Roths Wohnhaus.
Eine Telephonkabine und 98 Haushalte
«Ausser den neuzeitlichen Einrichtungen für den Postdienst steht im Schalterraum auch eine Telephonkabine zur Verfügung der Postbenützer», heisst es. Roth bediente zu Beginn 98 Haushalte mit etwa 230 Einwohnern und ging noch zweimal täglich auf Zustelltour und wurde von seiner Frau Klara Roth-Kuhn unterstützt. Als Roths 1990 in den Ruhestand gingen, übernahmen Hansruedi und Kornelia Müller. Sie mussten zuerst mit einem Provisorium vorliebnehmen, weil verschiedene Projekte der Post für einen Neubau gescheitert waren. Dazu mehr in den nächsten Folge. Weil die Poststelle 2002 geschlossen wurde, blieben Müllers das letzte Posthalterpaar im Mühlethal. Als Ersatz wurde der Hausservice eingeführt.